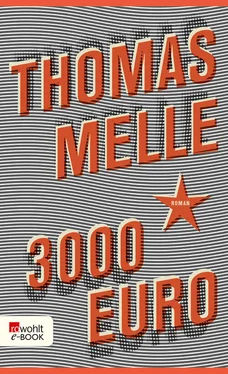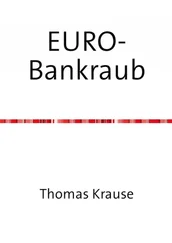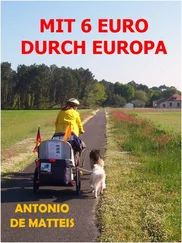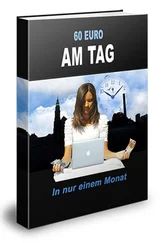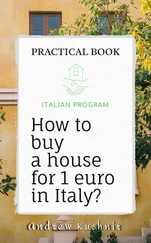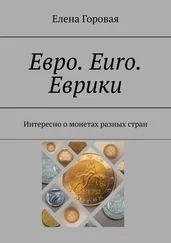*
Nachdem Linda, das Gesicht voller Trauer und Melancholie, in der Tagesstätte verschwunden ist, jeder stampfende Schritt ein Vorwurf gegen das Leben, das ihr von ihrer Mutter aufgefrachtet wurde, flüchtet sich Denise in das nächste Café, bestellt einen Milchkaffee und kommt sich auf unverschämte Weise korrigiert vor, als die Bedienung mit dem blonden Pferdeschwanz ihre Bestellung im Weggehen als «einen Latte» wiederholt. Sie checkt ihren Facebook-Account, macht Skype an und blättert dabei eine Frauenzeitschrift durch, die ihr nur die spießigste Mode als den neuesten Trend andienen will. Als der Latte kommt, will sie sich besonders süßlich bei der Bedienung bedanken, aber es misslingt ihr und hört sich eher bitter und unbeholfen als souverän an. Alle Beiläufigkeit ist verloren. Der Kaffee schmeckt nach Tee.
Sie ruft Anton an, aber wieder geht nur die Mailbox dran, ohne Namensnennung, mit dem akustischen Stück Straße, das sich wie ein Fetzen irgendeiner verlorenen Atmo anhört — oder schon wie ein Soundbit aus dem Jenseits? Ein leichter Schrecken durchfährt sie, es reift gar nicht zum ganzen Gedanken, und doch huscht die Frage kurz durch ihr Bewusstsein: Was, wenn es ihn schon nicht mehr gibt?
Sie verdrängt die Frage schnell, aber es bleibt ein dumpfer, undeutlicher Rest in ihr, ein Unbehagen, das sich bald zur Unruhe auswachsen wird, zumal sie sich zwei Tage freigenommen und somit nichts zu tun hat. Erholung schlaucht.
Auf Facebook das Übliche. Jemand hat sich getrennt und gleich noch das Profilbild geändert, andere gratulieren dazu und fragen, ob sie helfen können. Auf Skype wird Denise von Unbekannten angequatscht, denen sie irgendwann ihren Namen gegeben haben muss, in einer durchtrunkenen, verchatteten Nacht wahrscheinlich, wann sonst. In ihrer Nachrichtenbox blinken nur anonyme Einladungen zu irgendwelchen Clubevents, die sie nicht interessieren.
Anton geht ihr nicht aus dem Kopf. War morgen nicht der Gerichtstermin, von dem er sprach? Der Termin schien für ihn von besonderer Bedeutung zu sein. Vielleicht sollte sie hingehen und fragen, wie es ihm geht. Ihn unterstützen. Oder einfach nur da sein, um zu sehen, was diese Begegnung eigentlich sein soll, was sie sein könnte. Oder einfach, weil sie ihn vermisst, tatsächlich.
Kaum ist der Entschluss gefasst, fühlt sie sich besser. Mit einer arroganten Geste bezahlt sie ihren Milchkaffee, fixiert dabei die Bedienung, die ihrem Blick plötzlich nicht mehr standhalten kann. Die Verhandlungen sind öffentlich, weiß sie, es steht draußen angeschlagen, wessen Fall wo und wann abgefertigt wird. Das kennt sie noch aus den Zeiten mit Marc. Eigentlich hatte sie sich damals geschworen, nie wieder ein Gericht zu betreten, und schon gar nicht für jemand anders, ob als Begleitung, als Verstärkung oder als Zeugin. Nie wieder. Doch die Zeiten ändern dich, denkt sie, wieder mit Bushido. Und die Schwüre von gestern sind eh nur die Niederlagen von heute.
*
Auch Professor Stephan hat abgebaut, stellt Anton mit Schrecken, aber nicht ohne Genugtuung fest. Wie er da steht und nach Worten sucht, die Haare zotteliger, lichter, strohiger, die Gesten fahriger. Der Bauch spannt nicht mehr nur unterm Hemd, sondern lappt eigentlich schon über die Hose. Der Rotwein hat seine feinädrigen Spuren im Gesicht hinterlassen. Eine Koryphäe auf dem Gebiet des Zivilrechts und der Rechtsphilosophie, unterwegs zum halben Penner. Ob es da eine Scheidung gab? Einen Zusammenbruch? Burnout, Alkohol, Tabletten? Anton grinst. Ihn fragt ja auch keiner. Das ist der Lauf der Zeit, sagt der Stand der Dinge. Und lacht sich krank.
Er ist noch einmal in seine ehemalige Universität gefahren, den Ort seines Traumas und Scheiterns, wie er sie rückblickend verklärt. Das Neonlicht auf den Gängen kommt ihm noch greller und unfreundlicher vor als früher, der genoppte Boden quietscht unter seinen Sohlen, strahlt jetzt hellblau hoch, wo Anton drecksgelbe Mattheit in Erinnerung hatte. Die Mensa sieht inzwischen viel feiner und ordentlicher aus. Ohne Mensapass mit Magnetstreifen ist es einem leider gar nicht mehr erlaubt, dort zu essen, was Anton verärgert. Alles wird besser, nur ich verschlimmere mich, denkt er. Da kommt ihm der körperliche und geistige Abbau seines früheren Professors gerade recht.
Bescheiden sitzt er in der zweiten Reihe rechts außen und gibt vor mitzuschreiben. Die Studenten halten eine Art Sicherheitsabstand zu ihm, ob aus olfaktorischen oder visuellen Gründen, ist nicht feststellbar. Professor Stephan redet und redet, Zivilrecht, Handelsrecht, objektives und subjektives Recht. Die Vorlesungsreihe steht offenkundig noch ganz am Anfang, und schon wirkt Professor Stephan ausgelaugt, zerzaust und blutleer, rasselt mechanisch und wie auf Valium die Unterscheidungen herunter. Vielleicht ist Anton der Einzige, der diese Beobachtung machen, diesen offensichtlichen Verfall sehen kann? Höchstwahrscheinlich, denn er ist auch der Einzige, der überhaupt entsprechende Vergleichskriterien zur Verfügung hat. Keiner der anderen Zuhörer wird schon vor zehn Jahren hier gesessen haben. Anton blickt sich um, sieht die gestriegelten Scheitel, die Perlenketten, die Babygesichter, die ganze Blondheit hier, das erkennbar Arische. Das sind doch noch Kinder, denkt er, das sind Figuren wie auf Bisky-Gemälden, wie sollen die mich vertreten können, wenn es hart auf hart kommt?
Und doch hat Stephan noch immer etwas von der Lichtgestalt, die er für Anton war. Anton versucht, eine ausgewogene Blickpolitik zu betreiben, dem ehemaligen Vorbild weder zu direkt ins Auge zu sehen, noch seinen Blick ganz zu meiden. Nach der Vorlesung wird er ihn begrüßen, und vielleicht werden sie ein Glas Wein trinken zusammen, sich über das Leben und sein vertracktes Recht wundern, eine Lösung projizieren, eine Streitschrift planen. Wer weiß, was Professor Stephan in petto hat. Anton wäre zu manchem bereit.
«So ist also das subjektive Recht anzusehen als Befugnis, welche sich für den Berechtigten aus dem soeben definierten objektiven Recht als gesetztem Recht unmittelbar ergibt — oder aber als Befugnis, die auf Grundlage des objektiven Rechts erworben wird. Letzteres nennt man erworbenes Recht.» Anton schwirren die Begriffe um die Ohren. Aber ist das nicht genau sein Belang? Es gibt die objektive Grundlage, und es gibt die subjektive Ableitung, und diese ergibt sich entweder unmittelbar, oder sie wurde erworben, aber immer auf der Grundlage des gesetzten, festgeschriebenen Rechtes. Und ja, auf ihn trifft subjektiv die Geschäftsunfähigkeit zu, ein Paragraph im BGB, irgendwo bei der Hundert, wenn er sich nicht täuscht. Die Geschäftsunfähigkeit ist sein Recht, sein subjektives, ableitbares Recht. Das muss doch zu belegen sein.
Er lehnt sich zurück und hängt seinen Träumen hinterher, Träumen von Schuldenfreiheit und Paragraphen, die nur ihm entsprechen, während Professor Stephan weiter doziert. Seltsam, dass Anton die alten Begriffe so fremd erscheinen. Hat er sie damals nur falsch verstanden? Sollte er jetzt erst, als tatsächliches Opfer, ein Verständnis für das Faktische des Rechts entwickelt haben?
Als Professor Stephan ins Stocken und aus dem Konzept kommt, aus irgendeinem Grund, den keiner kennt, er selbst wohl am wenigsten, und fast schon stottert beim Blick auf seine Papiere, eine bestimmte Seite sucht und nicht findet, auf Sendung wie ein hilfloser Nachrichtenmoderator, was einen komischen Effekt zur Folge hat, den die Studenten mit einem leisen Kichern quittieren, weil sie gar nicht anders können — da wendet sich Stephan plötzlich, mit errötetem Kopf und glasigem Glotzblick, seinem ehemaligen Studenten Anton zu.
«Und Sie, was suchen Sie eigentlich hier?»
«Ich», sucht Anton nach Worten, «also, ich höre eigentlich nur zu.»
«Nein, ich kenne das, ich habe das schon im Kollegium besprochen», sagt Stephan. «Sie können hier nicht so einfach sitzen. Das ist nicht persönlich gemeint.»
Читать дальше