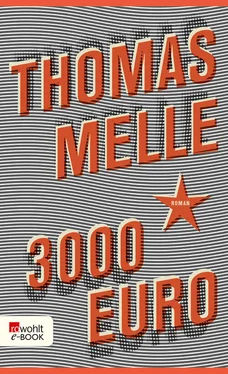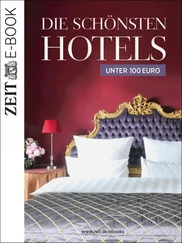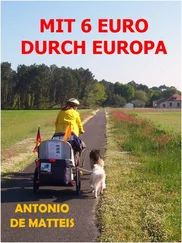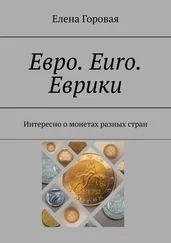*
Anton flaniert, wie man so sagt, aber es ist in Wahrheit kein Flanieren, es ist Streunen. Was ist der Unterschied? Tut er es nicht ebenso freiwillig wie irgendwelche Flaneure in den zwanziger oder Nullerjahren? Er ergeht sich in der Zeit und sondiert den Raum. Ist es also der fehlende Stil, der ihn zum Streuner macht? Er trägt noch immer einen Anzug, und im ausschreitenden Gestus seines Ganges kann man noch immer den gespielt selbstbewussten Dandy erkennen, die Beine in ihrer Bewegung fast schon eine Sinuskurve. Abgerissen sieht er zwar aus, nur kann man kaum glauben, dass die wandergetriebenen Literaten dieser oder jener Epoche nicht ebenso abgerissen durch die Gegend voller Gründerzeitbauten stakten. Alles Poser und Poseure, letztendlich, denkt er.
Vielleicht ist der einzige Unterschied, dass Anton nicht verweilen kann. Die Flaneure ließen den Blick schweifen und erkannten im Besonderen das besonders Allgemeine, im Detail die Lage. Anton dagegen ist getrieben von einer Leere, die ihn vor sich hertreibt, von einem Mangel in den nächsten. Der Blick will nicht ruhen. Die Füße sind müde, aber rastlos. Das ist noch nicht einmal mehr Streunen. Das ist lustlose Unruhe, eine träge Schneise, die sich sofort wieder schließt.
Er folgt einer diffusen Dramaturgie. Es gibt keine Lösungen mehr. Fühlt sich so ein Abschied an? Was muss man tun, um diese Probleme zu lösen? Was, um sich würdig zu verabschieden? Wieso überhaupt wen besuchen, wieso diesen stillen Abschied nehmen, wo ihn doch eh alle abgeschrieben haben? Und wieso in Dreiteufelsnamen noch irgendeine Romanze starten? Denise ist nicht interessiert an ihm, nicht genug, nicht so, wie er es von früher kennt. Eine Liebe sollte die ganze Existenz aus den Angeln heben können. Da sind aber nur Zaudern und Zagen am Start, und ausgehebelt ist sein Leben auch ohne sie, nämlich völlig entgleist, brutal zernichtet. Wieso also überhaupt noch etwas anfangen?
Soll sie zur Hölle fahren! Denise ist nichts anderes als die letzte Klaue der Gesellschaft. Die Menschheit will ihn noch einmal locken, mit kalten, schönen Augen und ein paar festen Brüsten. Die Menschheit klettet. Wenn Denise hier wäre, er würde ihr ins Gesicht spucken, denn sie steht für das Falsche, das sich noch einmal aufbäumen und ihn einnehmen will. Nein, natürlich nicht. Er würde sie nicht bespucken. Er würde sie aber auch nicht umarmen. Es hat keinen Sinn. Soll sie ihn einfach in Ruhe lassen, wie alle. Wenn es drauf ankommt, ist sie eh nicht da. Weg damit.
Dennoch will er den Abschied wenigstens für sich inszenieren, etwas zum Abschluss bringen, auch wenn er nicht recht weiß, wie. Der Gerichtstermin in zwei Tagen bringt die Zäsur. Aber sie kommt vom Staat, von oben diktiert. Fast schon ein Verrat an der eigenen Menschlichkeit, diesen Amtstermin zum Anlass zu nehmen. Aber Ämter schicken uns ins Leben mit einem Schein, und am Ende ziehen sie den Schein wieder ein. Anton wird wütend. Wozu Dramaturgie? Wozu Ämter? Genauso gut könnte er sich gleich vor den nächsten Zug werfen.
Probeweise steht er an den Gleisen. Der Schotter unter den Füßen fühlt sich grob an, drückt durch die Schuhsohlen. Wie einsam man hier ist. Da oben ist die sogenannte Böschung, ein seltsames Wort, das er nie ganz verstand. Anton stellt es sich vor, hier zu stehen und zu warten. Er stellt es sich vor und tut es zugleich, nur unter anderen Vorzeichen. Noch. Es muss der einsamste Moment sein, sich zu töten, sich wegzuwerfen, denkt er. Alle Selbstmörder haben etwas gemeinsam und sind doch die einsamsten Schweine. Hier sich also hinwerfen, und dann wirbeln die blutigen Glieder durch die Luft? Wie soll das denn gehen? Vielleicht wird man ja vom Druck einfach weggeschleudert und liegt dann dort oben in der sogenannten Böschung, querschnittsgelähmt. Oder soll er seinen Kopf auf die Gleise legen, um flugs geköpft und von allem schnell abgeschnitten zu werden? Was wäre das denn für eine Selbstguillotinierung? Wie kommt man dahin, so etwas überhaupt zu denken? Wo andere, in Geschichtsbüchern, in Revolutionen, ihren Kopf wenigstens im Namen von Ideen und Idealen verloren, da hätte diese Enthauptung überhaupt keinen Sinn. Anton würde sein Leben gerne jemand anderem schenken, einem krebskranken Kind etwa oder einem Familienvater, der bald von einem Herzinfarkt ereilt wird. Doch gibt es in Sachen Lebenskonten noch keine Überweisungsmöglichkeiten. Verquere Gedanken! Anton, der Zauderer, wartet. Er will nicht leben und auch nicht sterben. Er will abgeschafft sein.
Dort hinten naht ein Zug. Erst nur ein Wurm, der um die Ecke biegt, wird die Schlange immer größer und bekommt ein Gesicht, das keine Regung zeigt. Jetzt schon ist das Dröhnen zu erahnen, das hier gleich Hören und Sehen vergehen lassen wird. Schrill und schriller brettert der Zug heran. Anton stellt sich vor, wie es sein muss, sich jetzt auf die Gleise zu — legen? Werfen? Setzen? Nimm mich auf, nimm mich an, fetz mich einfach auseinander?
Es ist offensichtlich gar nicht möglich. Ein Rätsel, wie andere das geschafft haben. Anton jedenfalls kann das nicht. Schon dröhnt der Zug vorbei, schreit ihn an, schrill und hochgepitcht, weht und wirbelt alles auf, den Staub, die Luft, das Denken. Verloren ächzt Anton die Böschung wieder hinauf. Jetzt versteht er das Wort besser.
*
Nimm dir, was du brauchst, auch wenn nicht klar ist, was du willst. Denise fragt sich, ob es vielleicht ein Mann ist, den sie jetzt braucht. Ausgehen kann sie nicht, doch wenn Linda schläft, später, könnte sie jemanden empfangen. Nur wen? Bei Anton geht nur die Mailbox dran, Straßengeräusche im Hintergrund, noch nicht einmal seinen Namen hat er draufgesprochen. Und sie weiß nicht, ob sie ihn überhaupt verführen will. Es sollte sich einfach ergeben, ungezwungen, von selbst. Schon wird es kompliziert mit dem Brauchen und Wollen. Schon stehen die Gedanken bisschen quer.
Sie geht ihre Kontakte im Handy durch und entdeckt manch alten Bekannten. Eike, Sommerlover von vor drei Jahren: inzwischen verheiratet, ob glücklich, weiß der Wind. Gürol, zarter Stiefelfetischist: eigentlich, so der bleibende Eindruck, schwul, mittlerweile mit Knasterfahrung. Heiner, Fastbeziehung, Stalkingterror durch nächtliche Anrufe im Suff. Max, unglaublich gut ausgestattet, aber mehr auch nicht. Robby, gerne genommen, fast verliebt, dann aber Neigung zur Gewalttätigkeit sowie mannigfache Untreue. Und die Namen, die sie gar nicht mehr zuordnen kann, wer bitte sind Safran, Piet, Claudius und Wolle?
Fränkie wäre eine Möglichkeit, der wird noch immer herumstreunen und herumhuren, wenn auch auf hohem Niveau, wie er immer sagte. Oder Peer. Peer, der eigentlich Ungeküsste. Der schüchterne Beau, der, wie so mancher, nicht küssen konnte. Denise begreift nicht, wie man nicht küssen kann. Das hat etwas mit Durchlässigkeit zu tun, denkt sie, mit der Fähigkeit, sich auf andere einzulassen. Und wer kann das nicht wenigstens in Ansätzen? Aber nein, Peer war entweder zu passiv und ließ die Zunge wie eine soeben gestorbene Schnecke in ihrem Mund liegen, oder er wurde aus panischem Übereifer grob und fuhrwerkte dann mit seinem wiederbelebten Fleischmuskel hyperaktiv in ihrem Mund herum. Was ein Stress. So ähnlich war es dann auch im Bett.
Roland also wieder. Roland, Mitte dreißig, Supervisor in einem Meinungsforschungsinstitut, sehnsüchtig, bindungsunfähig, höflich, auf der Flucht. Schon zweimal in diesem Jahr hat sie ihn aus dem Nichts aktiviert, es reichten drei, vier Kurznachrichten, und er stand auf der Matte und zur freien Verfügung, um genauso unverbindlich wieder abzuhauen morgens, lang vor einem möglichen Frühstück. Ein zweckdienlicher Notnagel in Zeiten der Geschlechtsdürre.
Denise formuliert an einer Einstiegs-SMS herum, ein neutrales, freundliches Wie-geht-es-dir ist zu wenig, eine zweideutige Anspielung zu viel. «Hast du heute Zeit?» wäre vielleicht das Ehrlichste, und sie tippt es ein, merkt dann aber, dass das bedürftig bis notgeil wirkt. Sie löscht es wieder. Schließlich einigt sie sich mit ihren Selbstzweifeln auf ein unbedarftes, in seiner Kürze freches wie gemäßigt herausforderndes «Na?», sieht es an und ist zufrieden. Sie schickt es ab, bevor sie es sich anders überlegen kann, und wendet sich dem Geschirr zu, das noch gespült werden muss. Das Wasser läuft und wird nicht warm. Sie behält das Handy im Auge. Nichts geschieht, nur der Tellerberg in der Spüle wird langsam kleiner, die Hände kälter. Energieaustausch, denkt sie. Dann summt es endlich.
Читать дальше