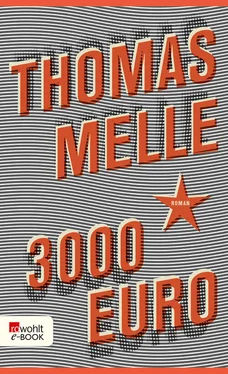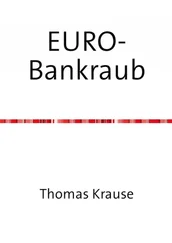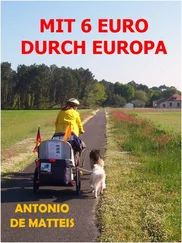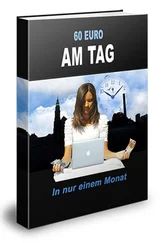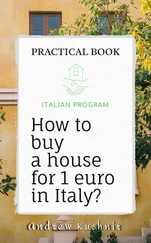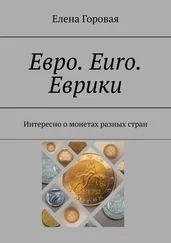Dreitausend Euro sind es. Mehr eigentlich, addiert man alles zusammen, etwa zehntausend insgesamt, aber gerade geht es nur um dreitausend Euro. Dreitausend Euro, denkt Anton, während er durch die U-Bahn wankt, dreitausend Euro, wie viel ist das, wie wenig. Der Gerichtstermin rückt näher, noch zehn Tage. Anton hat sich diese Frist gesetzt. Bis dahin will er — und er denkt den Ausdruck wörtlich und grinst darüber — klar Schiff gemacht haben. Das Wort Deadline vermeidet er. Draußen ziehen die Gebäude vorbei, die Schulden der anderen. Anton rechnet mit und nickt.
Er singt in Gedanken, 3000 Euro, 3000 Euro ; und ganz leise singt er auch wirklich, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Lippen formen ein paar Verse, die nichts bedeuten und nicht hängenbleiben. Früher hat das Singen ihm geholfen, sich zusammenzuhalten, sich neu zu formieren, und die Schülerband war ein gutes Vehikel zum kurzzeitigen Ausbruch aus der Familie gewesen. Jetzt passiert es nur noch selten, das Singen, und wenn, dann unbewusst. Wie jetzt. Die anderen Passagiere ignorieren sein Singen. Bei ihnen kommt es wohl als Wimmern an.
Supermärkte sind meist rot oder gelb. Rot steht hierbei für höherwertig, gelb für billig. Anton betritt den Supermarkt, natürlich einen gelben. Die Massen an lieblos aufgestapelten Waren sagen ihm nichts. Schon früher hat er es immer gehasst, für sich alleine einzukaufen, und wenn er heute manchmal noch einkauft, erinnert ihn das stets an die furchtbare Bedrücktheit, die er schon vor Jahren dabei gespürt hat, allein mit sich und den Waren. Das Piepen der Kassen schneidet durch die Luft. Einzelne Personen huschen durch die Gänge. Er nimmt Bananen in die Hand und tut so, als würde er sie begutachten. Dann lässt er sie in den Korb fallen. Vor dem Kühlregal angekommen, kann er sich zwischen all den Billigwürsten nicht entscheiden. Er greift nach dem rohen Bauernschinken, den er früher immer mitnahm, und legt ihn in den Korb. Am liebsten würde er sich einfach dazulegen. Von den Toastbroten wählt er den Vollkorntoast, von den Buttern die billigste, von den Milchtüten die blaueste. Bei der Cola fragt er sich, ob das Pfand für die Flasche auch bei anderen Märkten einlösbar ist. Dann schmunzelt er ob solcher Überlegungen. Schließlich verstaut er den halb vollen Korb irgendwo zwischen den Waschmitteln und geht zum Pfandautomaten. Eine Flasche nach der anderen schiebt er in das verschmierte Loch und sieht den Betrag dabei langsam wachsen. Hinter ihm macht eine Frau durch Flaschenklimpern auf sich aufmerksam. Gleich fertig, versucht er telepathisch zu übermitteln.
Schließlich kauft er eine Salamipizza, um kein Aufsehen zu erregen. Die Kassiererin kennt er, sie ist auf prollige Weise sehr hübsch, und manchmal denkt er, wieso nicht so jemand.
Zuhause angekommen (er will es nicht «Zuhause» nennen!), huscht Anton ins Gemeinschaftsbad, es ist nicht besetzt, und verriegelt hinter sich die Tür. Geschafft, sagt es in ihm, und er entledigt sich schnell seiner Kleider. Der Hahn wird aufgedreht, das Wasser sprudelt stoßhaft los. Er hat sich entschieden, ein Bad zu nehmen, wennschon, dennschon. Eine leere Duschgelflasche füllt er auf, schüttelt sie und kippt das leicht schaumige Wasser wieder in die Badewanne. Heiß bitte, noch heißer. Einen Fuß taucht er probeweise ins Wasser, die Drecksflecken lösen sich sofort auf; es ist zu heiß, er mischt etwas kaltes Wasser hinzu.
Anton hat immer länger als andere gebraucht, um die eigene Lage zu erkennen. Als er die Pubertät bemerkte, war sie fast schon wieder vorbei. Dann dauerte es fünfzehn Jahre, bis er erkannte, dass er «seelisch labil» ist, wie es im Sozialarbeitersprech jetzt heißt. Und zuletzt mussten etwa sechs Wochen verstreichen, bis er sich eingestand, obdachlos geworden zu sein. Solange man noch im Kontakt mit irgendwelchen Ämtern steht, kann man sich über den eigenen Status hinwegtäuschen, hat man das soziale Netz noch auf Tuchfühlung. Seit ein paar Tagen aber weiß er: Jetzt ist er obdachlos, jetzt ist er unten. Wie lange schon? Seitdem er im Übergangsheim wohnt? Glauben kann er es aber noch immer nicht ganz. Manchmal hält er unvermittelt inne und fragt sich, ob das wirklich er ist, der da gerade Flaschen aus dem Mülleimer fischt, der schlecht riecht, abgerissen aussieht, mehr torkelt als geht. Ich? Wirklich? Das war doch mal ganz anders gedacht. Dann aber geht das Torkeln weiter, und die Selbstvergessenheit, und das sinnlose Ablaufen der Momente. Und doch, den Kopf hält er hoch dabei, so hoch es eben nur geht.
Er taucht ein, das Wasser verfärbt sich und stichelt heiß und angenehm. Das ist genießbar wie nur noch wenig. Manches Essen macht noch Freude, der Cheeseburger vorgestern etwa, die Gulaschsuppe in der Volksküche vor einer Woche. Und jetzt, dieser Verlust von Gewicht, eine Wohltat, die Schwere schwindet kurz aus den Gliedern, die Hitze wandert in den Körper ein. Er wäscht sich, wie er es gelernt hat. Dann liegt er da, lässt bisweilen heißes Wasser nachlaufen, gerade so, dass es noch erträglich ist, liegt da und ist einfach, ohne viel zu denken. Schließlich wird es ihm zu langweilig, und er zieht den Stöpsel, duscht den Drecksfilm auf der Haut ab und steht auf. Durch das Fenster winken die Bäume. Es ist wohl ein schöner Tag.
Draußen auf dem Flur sind Schritte zu hören, ein Klopfen an der Bürotür, jemand redet aufgeregt. Wieder ein abgewiesener Antrag, irgendeine Unverschämtheit vom Amt, Anton kennt den empörten Tonfall des Unverständnisses, der sofort aufgefangen und kanalisiert wird, diesmal von Sonja, die Schicht zu haben scheint. Sonja ist auch Antons Sozialarbeiterin. Der Redeschwall versiegt, im Büro wird sich der Sache angenommen. Anton hört die Stimmen nur noch abgedämpft. Er zieht sich an, bemerkt jetzt erst den stechenden Geruch seiner Kleidung. Vor dem Spiegel richtet er sich das Haar, fährt mit den Fingern durch die Strähnen. Im Gesicht kommen ihm nur noch die Augen entfernt bekannt vor. Dann packt er seinen Rucksack und horcht, ob die Luft rein ist. Er öffnet die Tür und schlurft eilig in den Flur, nur drei, vier Schritte, dann ist er in seinem Zimmer. Es begrüßt ihn die Unordnung. Es begrüßen ihn die tausend Formulare und Schreiben, die er in zwei Ecken geworfen hat. Links die Rechnungen und Mahnungen und Inkassoschreiben und Gerichtsvorladungen und Urteile. Und rechts die anderen Briefe und Zuschriften, die er schon nicht mehr öffnen konnte. Vielleicht ist ein Haftbefehl darunter, vielleicht auch nicht.
Harald Schmidt macht einen Witz. Er macht das auf die gespielt naive Weise, die eine angebliche Empörung als überraschendes Politikum ausstellt und meist mit «Aber entschuldige mal bitte …» anfängt. Das Publikum schmeißt sich weg, und Andrack presst ein nasales Grunzen hervor. Anton wacht auf, aber nicht von Schmidt, sondern von dem verbrannten Geruch in seinem Zimmer, von den Rauchschwaden, die aus Richtung der Kochecke kommen und ihn jetzt aufscheuchen. Seine Pizza ist verkohlt.
Nachdem sie vor der kleinen, offenen Fensterscharte seiner Kochecke kalt geworden und der Rauch größtenteils abgezogen ist, begutachtet Anton die Pizza, schabt den dunklen Rand ab und isst sie schließlich am Tisch. Asche in sein Maul. Währenddessen klickt er eine neue Folge der Harald-Schmidt-Show an. Die Leute auf YouTube haben eine Menge Folgen hochgeladen. Anton sieht am liebsten die klassische Phase zwischen 11. September 2001 und der sogenannten Kreativpause Ende 2003. Da hatte Schmidt die größte Sicherheit und den meisten Spaß, und auch Anton ging es damals gut, mit Nicole, seiner Freundin. Er glaubt es kaum, dass das weit über zehn Jahre her sein soll. Eigentlich lebt er, kulturell gesehen, noch immer in dieser Zeit, die Witze versteht er alle, egal wie zeitbezogen, die Prominenten sind ihm sämtlich vertrauter als die gängigen Namen von heute.
Читать дальше