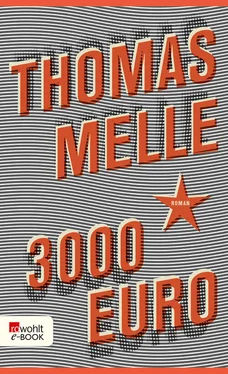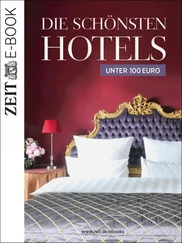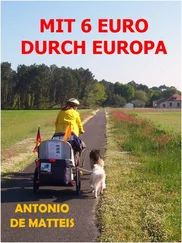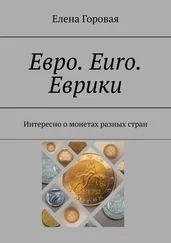Nachdem sie Linda im Hort abgegeben hat, checkt sie im Bus einen ihrer drei Facebook-Accounts: den, der mit Badoo verknüpft ist. Fünf neue Nachrichten, zehn neue Freundschaftsanfragen. Sie nimmt alle an. Danach checkt sie ihren Kontostand. Noch immer nichts eingegangen. Auf WhatsApp hat ihr Fred einen vertrockneten Blumenstrauß geschickt, im Gegenlicht auf dem Küchentisch, was poetisch und zugleich vorwurfsvoll sein soll, oder melancholisch, Denise kann es nicht recht verstehen, und Anja hat ihren Sohn mit Burger-King-Krone und missgelaunter Ketchupschnute abgelichtet, was vermutlich süß sein soll. Denise macht als Antwort ein Bild von sich, findet das dann aber selbstverliebt und sich selbst, wie sie da im grauen Bus sitzt, eh hässlich. Sie löscht es, steht auf und verlässt den Bus.
Und schwitzt. Eigentlich hatte sie das Schwitzen überwunden, durch Autosuggestion und ein mehliges Antitranspirant aus Kalzium und Talk, aber in den letzten Tagen ist es zurückgekommen. Es liegt in der Familie. Ihr Großvater hatte immer so stark geschwitzt, hieß es, dass er sich regelmäßig die verkrusteten Achselhaare stutzen musste. Solche Details bleiben haften, auch wenn sie nur einmal erwähnt werden.
Und jetzt sie, hier an der Kasse, am Förderband. Sie spürt den Schweißfilm auf der Stirn, die Nässe am Rücken. Sie schämt sich dafür. Das ewige Einerlei der Kassentöne und Waren macht sie schon lange nicht mehr schwindlig. Aber die Blicke tun es, neuerdings. Vielleicht bildet sie sich alles auch nur ein? Automatisch schiebt Denise die Waren über den Scanner, es piept und piept und piept, dann die Geldübergabe, gerne auch Eurocard, Kasse auf, Kasse zu, Unterschrift her oder Wechselgeld hin, und heimlich prüfen, ob ihr kein Falschgeld untergejubelt wird.
Sie meidet die Blicke der Kunden, vor allem die der männlichen. Sie triefen vor Geilheit, das weiß sie, und sie haben allen Grund dazu. Nein, sie triefen nicht. Sie sind einfach nur da, streifen ihren Lidschatten, tasten ihren Mund ab, bleiben an ihrem Piercing hängen, verbeißen sich in ihrem Auge, wenn sie nicht schnell genug wegsieht. Sie fahren ihr über Schenkel und Brüste und Bauch und Hals. Normal, würde sie sagen, wenn es nicht diesen Moment gäbe, wo es kurz im Gesicht des anderen zuckt, wo sich vielleicht die Pupillen zusammenziehen, wo irritiert erst weggesehen, dann wieder hingesehen wird. Wer ist das? Kenne ich die nicht? Ich kenne sie. Woher? Doch nicht etwa — ? Doch, doch, denkt Denise dann, genau daher, genau daher. Sie hat inzwischen ein kaum merkbares Lächeln als Maske gewählt, wenn die Scham ihr Nadelkissenwellen den Rücken hinunterschickt. Gerade steht wieder einer vor ihr, ein Student vielleicht, mit rasierter Brust und einem T-Shirt mit einer Waschmaschine drauf, und scheint nervös. Ist sie es? Ist sie es nicht? Sein Blick schweift umher, bleibt dezent an ihr hängen, dann sucht er vorauseilend das Geld aus dem Portemonnaie zusammen, rechnet mit der Kasse um die Wette. Nein, entscheidet sie, der hier kennt sie doch nicht. Jedenfalls nicht auf die obszöne Weise. Jedenfalls nicht aus dem Internet. Er kennt sie von hier, von der Kasse, er ist normal, sie ist normal. Die Kasse geht auf, geht zu. Sie muss nicht lächeln. Sie muss gar nichts, nur arbeiten. Sie ist nicht die aus dem Internet, sie ist die aus dem Supermarkt. Nächster.
Spaghetti, Spaghetti, Tomatenmark, Bier und Katzenfutter. Es stellen sich keine Bilder der Wohnungen und Kühlschränke dazu mehr ein, es ist eher wie eine Notenvergabe, ein schnelles Einschätzen des Lebensstandards, was eigentlich verboten ist. Man soll blind sein. Die Kundin hat es ihrerseits auch eilig und würdigt Denise keines Blickes. Sie hat Elefantenhaut im Dekolleté und ein feines Nest aus geplatzten Äderchen an den Nasenflügeln. Aber sie war einmal schön, das strahlt das ganze Leben nach, und sei es in der tragischen Aura des Verlustes. Denise nennt die Endsumme, sie muss an das Wort «Endgegner» denken, an Bushido, und schon hält sie wieder alle Männer, zumal die, die in ihrer Schlange stehen, für aggressive Schweine. Und es stehen wieder ausschließlich Männer in ihrer Schlange. Und ja, ihre Blicke triefen wieder vor Geilheit. Ein Schweißtropfen rinnt ihr über die Schläfe, am Ohr vorbei, sie wischt ihn beiläufig weg. Vor ihr steht ein gut gekleideter Mittfünfziger und sieht nach echtem Wohlstand aus, ungewöhnlich für hier, er hat nur ein paar Gemüsetüten auf das Band gelegt. Sicherlich hat seine Frau ihm das noch für den Nachhauseweg aufgetragen, aber bitte beim Biomarkt, und er hat den nächstbesten Discounter genommen, es wird schon keiner merken. Er sieht sie durchdringend an, vielleicht soll es auch freundlich sein, und kurz ist sich Denise sicher, das ist er, das ist der Mann, der sie heute erkennt, der sich in einsamen Minuten für sie entschieden hat, der sie benutzt, sich an ihr vergangen hat, der ihr stellvertretend für die anderen gleich ein eindeutiges Zeichen geben wird, und sie weiß nicht einmal, ob sie sich dann geschmeichelt oder gedemütigt fühlen soll. Sie weicht seinem Blick aus, landet bei anderen Blicken, Schweine oder Nichtschweine, und stellt den Kopf, so gut es geht, auf Leere, auf Standby um, nur noch Zahlen haben Zutritt. Ihre Hände sollen die Arbeit einfach verrichten, nicht zittern. Es geht.
Hinten am Pfandautomat steht wieder der Typ, der anscheinend Flaschensammler ist, aber so wirkt, als mache er das nur aus Spaß oder als Projekt. Denise kennt sich nicht aus bei Projekten, aber sie weiß, dass die halbe Stadt aus ihnen besteht. Der Typ, den sie «Stanley» nennt, sieht aus wie ein Student, der zu lange freihatte, oder der sich in seinem Projekt, dessen Sinn Denise nie verstehen würde, völlig verloren hat. Er ist einer von denen, die sich immer bei ihr anstellen. Doch bei ihm hat sie keine Paranoia. Sie weiß, dass er sie nur von hier kennt, und selbst wenn nicht, wäre es bei ihm nicht so schlimm. Er hat etwas Sanftes, Fremdes. Gleich ist er dran und wird, das hat sie schon erfasst, mit dem Pfandbon eine der billigen Tiefkühlpizzen kaufen. Keinen Alkohol. Alkohol kauft er nie. Jedenfalls nicht bei ihr.
Als Stanley vor ihr steht und grüßt, kann sie sich zu einem Lächeln durchringen, das sich wirklich wie ein Lächeln anfühlt. Gleichzeitig nimmt sie seinen strengen Geruch wahr, der auf dem Weg zum säuerlichen, dichten Gestank der Obdachlosen ist, aber noch nicht ganz. Sie muss sich schütteln und verbirgt das hinter einem Husten. Freundlich verabschiedet er sich, und sie blickt ihm hinterher. Als er aus der Tür ist, sieht sie ihn als Penner in New York, im Hoodie, vor einer brennenden Tonne, wie im Hip-Hop. Er hat die Kapuze auf und wärmt sich die Hände. Doch furchtbar, er kommt dem Feuer zu nahe und verbrennt im Zeitraffer, wird völlig zu Asche, die wild und in Spiralen nach oben steigt.
«Entschuldigung, ich muss auch nach Hause», sagt eine Frau, und Denise erschrickt und nickt und schüttelt dann den Kopf, während ihre Hände schon wieder am Werk sind.
*
Humpeln die Penner an uns vorbei, berührt uns das unangenehm. Nicht nur ist es eine ästhetische Belästigung, sondern auch ein moralischer Vorwurf. Wieso bitte ist dieser Mensch so tief gesunken, welche Gesellschaft lässt einen derartigen Verfall zu? Das ist schon kein Mensch mehr, das ist ein Ding. Dann geht man weiter, angewidert fast, und verscheucht den Eindruck, lässt das Ding hinter sich zurück. Ein Schicksal, ja, unter vielen, und sicher nicht meins. Man hat Zeitungsgedanken, erinnert sich an Statistiken, auch wenn man sie nicht aufsagen könnte, und doch, kürzlich hat man da doch etwas gelesen, die Zahl der Wohnungslosen hat wieder dramatisch zugenommen, im Osten oder im Westen, oder war es nur in den Großstädten? und ordnet dieses Menschending irgendeinem abstrakten Gesellschaftskommentar zu. Der Diskurs kümmert sich schon drum. Die Gesellschaft ist im Grunde nicht böse. Und das Gesicht, das einen angeblickt hat, verschwimmt zu comicartiger Versoffenheit, zu einer Karikatur seiner selbst. Weg damit.
Читать дальше