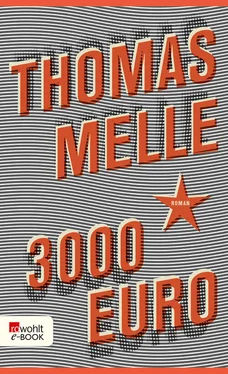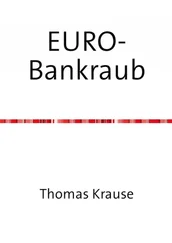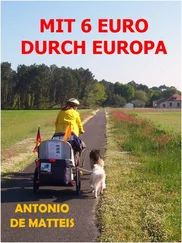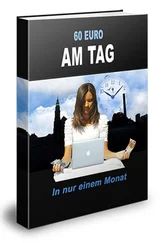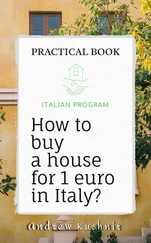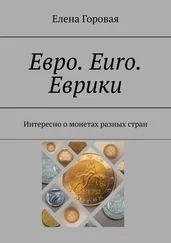«Ich habe einfach Scheiße gebaut, und jetzt muss ich die Suppe auslöffeln. Und es fällt mir schwer.»
Damit gibt sich Denise fürs Erste zufrieden. Sie kennt Derartiges.
Themenwechsel. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, nimmt sie den Faden auf und erzählt von ihrer Tochter, von den Begutachtungen, den Ämtergängen, den tausend Terminen, die sie abklappern muss, nur um ein paar Förderstunden mehr in der Woche herauszuschinden und ihrer Tochter gleichzeitig eine Art Behindertenstempel aufzudrücken. Wahrnehmungsstörungen habe ihre Tochter, sagt Denise, und von so was hat Anton noch nie gehört, aber er verbucht das nicht gleich unter Modekrankheit, unter ADHS und Burnout, den neuesten Blasen des menschlichen Symptompools, sondern versucht, es nachzuempfinden: die Größe der Welt im Auge des Kindes, das Unübersichtliche, die Formen und Farben, gegen die es läuft, an denen es sich stößt.
Anton war schon immer empathisch, was die Krankheitsbilder anderer angeht, so sehr, dass er die Symptome des Gegenübers bald schon bei sich zu bemerken meint, durch Übertragung und Aneignung, was selbstverständlich auch einen Zug ins Egozentrische offenbart. Fürsorge als Brandmarkung, Empathie als Egozentrik, die Fronten sind verwirrend heutzutage, denkt oder sagt er und nimmt einen weiteren Schluck. Sie schweigen. Er spürt die Sonne auf der Haut und empfindet sie nicht als Belästigung. Das Schweigen dauert etwas zu lange, und gleich sieht er die Skepsis wieder in ihr hochkommen, die Härte und Distanz, die sich solche Stadtschattengewächse früh aneignen. Vielleicht sollte er ihr noch etwas Alltägliches sagen, etwas, woran man anschließen kann.
«Gehst du manchmal aus?»
«Selten.»
«Und wohin?»
«Wenn ich dir das jetzt sage, stehst du aber nicht jede Nacht davor, oder?»
«Nein.»
«Selten, und wenn, dann ins Clark’s.»
«Kenne ich nicht.»
«Ist auch nichts für dich.»
«Wer weiß. Bist du heute da?»
«Nein. Ich sage doch, selten.»
«Ich gehe gerade auch nicht mehr aus. Es gab eine Zeit, da bin ich viel ausgegangen, dann zu viel, viel zu viel.»
«Ich auch.»
«So viel, dass es mich aus der Bahn geworfen hat.»
«Drogen?»
«Nein. Anderes.» Er schweigt. So wird das nichts mit dem Unverfänglichen, Alltäglichen. Immer wieder kommt er auf seine Lage zurück.
«Ich habe einen Rechtsstreit mit der Deutschen Bank. Es geht um dreitausend Euro. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.»
«Die schulden die dir?»
«Ich denen. Aber ich kann nichts dafür. Oder doch. Schwer zu erklären.»
«Haben die wieder Scheiße gebaut, was.»
«Ja. Ich zwar auch, aber die auch. Egal.»
Denise denkt, gar nicht egal, aber sie will nicht nachbohren. Der Typ berührt sie, irgendwie.
«Wenn ich wieder mal ins Clark’s gehe, kannst du ja mitkommen. Aber schön rasieren vorher», sagt sie.
Er lacht. «Klar! Aber die Augenbrauen kann ich so lassen, ja?»
«Wieso Augenbrauen?»
«Die werden doch gewachst neuerdings.»
Sie unterzieht ihn einer eingehenden Prüfung.
«Nein, die gehen. In der Dunkelheit fällt das eh kaum auf.»
Anton weiß, dass das keine wirkliche Aufforderung zum gemeinsamen Ausgehen ist, sondern ein Kontaktangebot. So interpretiert er das jedenfalls.
Und beißt mit Vergnügen an.
Als Denise geht, zurück zu ihrer Tochter, den Wahrnehmungsstörungen, dem Anton völlig fremden Leben, fühlt er sich leicht. Er hat nicht geflirtet, und doch ist er ihr nähergekommen. Er hat so wenig wie möglich gelogen und gespielt. Denise hat ihn auf ganz eigene Weise berührt, und vielleicht beruht das auf Gegenseitigkeit. Kurz bevor sie um die Ecke des Supermarkts verschwindet, dreht sie sich noch einmal um und winkt. Er winkt zurück und fühlt sich wie in einem Film, einer Sommerromanze mit offenem Ausgang. Als er sie nicht mehr sieht, schenkt er sich ein weiteres Glas Champagner ein und ist in völligem Einklang mit sich, mit sich und dem Quader von Supermarkt dort drüben, mit sich und der Welt. Nur neues Handyguthaben wird er kaufen müssen. Das ist klar.
Sonjas Dackelblick ruht auf Anton und menschelt. Sie mustert ihn, ordnet ihn ein.
«Wie geht es dir denn», sagt sie.
«Was soll ich sagen», sagt er.
Der Blick der mitfühlenden Sozialarbeiterin. Ein Ruck, ein Vergeben. Und die Einladung zum Kaffee, die Anton nicht ausschlagen kann. Im Büro liegt alles ordentlich an seinem Platz, Kugelschreiber, Schere, Stifte, Tastatur. Sogar die chaotischen Notizen auf dem Tischkalender verströmen diesen Ordnungssinn. Anton weiß, es gibt wieder einiges zu besprechen, Forderungen müssen beantwortet, Strafbescheide abgewendet, mit Ämtern muss telefoniert werden, immer unter Sonjas sanfter Aufsicht. Sie kommt aus der Küche und stellt ihm den Kaffee hin, sinkt in ihren Bürosessel und sieht ihn großäugig an.
«Ich weiß, ich sehe nicht gerade gut aus», sagt er.
Das habe sie nicht sagen wollen, aber es stimme schon, antwortet Sonja. Immerhin sei er ja frisch gewaschen. Sie lacht versuchsweise.
Schweigen. Die Birken draußen rascheln im Sonnenschein. Anton versucht, die Gier, mit der er das Kuchenstück verschlingt, zu kaschieren.
«Also.»
Das Sozialamt müsse Antons Bedürftigenstatus verlängern, die Gläubiger müssten beschwichtigt und vertröstet werden, es sind etwa dreißig, und manche hätten bereits einen Titel und den Zwangsvollzug angeordnet. Die Gerichtsvollzieherin war tatsächlich vor drei Wochen schon da, Anton tat trotzig bis arrogant, eine Haltung, die er den meisten Offiziellen gegenüber an den Tag legt. Selbst gegenüber Sonja. Die legt ihm nahe, einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen, damit er sich bei anderen sozialen Einrichtungen bewerben könne, eine Stufe höher, denn hier sei er ja auch irgendwie falsch. Anton nickt. Er macht ja alles, was Sonja sagt. Das unterscheidet ihn von den anderen Heimbewohnern. Anton tut arrogant, aber er ist sehr kooperativ, seit Sonja meinte, er müsse die Hilfe eben auch annehmen, sonst bringe das alles nichts.
Der Gerichtstermin ist in einer Woche. Antons Zustand schwankt zwischen Nervosität und Gleichgültigkeit. Er hat inzwischen einen großen Trotz gegen das Leben entwickelt, eine Egalheit, die ihn schützt, und doch spürt er das Bedürfnis, dieses Leben, das noch immer sein Leben ist, wieder in die Hand zu nehmen und in den Griff zu bekommen. Also tut er, was man ihm aufträgt, und schottet sich gleichzeitig ab: Es ist doch eh alles egal. Wer so weit draußen war, kann nicht wieder zurück. Der Gerichtstermin wird die Weichen stellen. Sollte Anton verlieren, und alles sieht danach aus, wird er drastische Konsequenzen ziehen. Sollte er gewinnen, wird er versuchen, wieder ein guter Erdenbürger zu sein. Entscheidungen müssen getroffen werden. Da kommt so ein Gerichtstermin gerade recht.
Dabei, und das weiß Anton im Grunde genau, ohne sich es ständig bewusst zu machen, ist das Urteil so gut wie gefällt. Der Gutachter hat ganze Arbeit geleistet. Absurderweise wollte der Zufall es so, dass der Gutachter auch Chefarzt der Klinik war, in die sich Anton in jenem verrauschten Sommer hatte einliefern lassen. Anton kannte ihn noch, wusste aber, dass der Gutachter, Professor Venth beim Namen, sich nicht an ihn erinnern würde. Chefärzte werfen nur alle drei Wochen einen Blick auf die Patienten. Und es war nicht klar gewesen, ob es einen Vorteil darstellte, dass Anton nun in ebenjenem Krankenhaus begutachtet wurde, in dem er vor einem guten Jahr noch stationär behandelt worden war. Der Flügel, in dem der Chefarzt residierte, sah schon einmal sehr anders aus als die Station, in der Anton interniert gewesen war. Hier war alles sauber und weitläufig, eine weiß strahlende Sitzgruppe lud zum entspannten Niedersinken und schüchterte den Wartenden zugleich ein.
Читать дальше