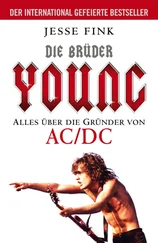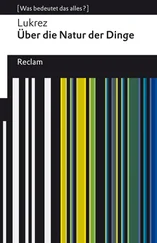Alfredo schwieg fragend.
Das sei es doch, sprach sie weiter, was er den ganzen Tag über tue! Er spiele den Moralapostel, mache alles schlecht, aber im Grunde sitze er im Sessel, gehe in drittklassige Theateraufführungen, in denen er einschlafe, und … abends koche er! Bei diesen letzten Worten entfaltete sie ihre Arme und warf die Hände in die Luft.
Alfredo schob seine Schultern zurecht, die sich vor Empörung verschoben hatten.»Und? Was ist schlecht daran, abends zu kochen ?«, sagte er und imitierte die Art ihrer Betonung, den deutschen Akzent, was sie für geschmacklos hielt.
Jetzt schrie sie:»Komm doch mal einen Tag in die Klinik, dann weißt du, was ich meine!«, schrie sie, nun absichtlich laut.»Das Leben besteht nicht aus Bücherlesen, verstaubten Theateraufführungen und abends kochen! Wenn du nur ein einziges Mal ins Poliklinikum kommen würdest, dann würdest du sehen, was los ist!«, schrie sie, meinte aber: … dann würdest du sehen, wie ich mich beim Mittagessen von den Blicken eines Bourgeoisie-Bübchens verspeisen lasse .»Dort, im Poliklinikum, werden nicht den ganzen Tag über Reden geschwungen, dort wird gehandelt!«, schrie sie und meinte: Dort wird mit der Hoffnung der Menschen viel Geld verdient! »Gute Nacht!«
Alfredo hatte den Mund fest verschlossen, wie um zu verhindern, dass dort etwas herauskäme, das er später bereuen würde. Auch das regte Betty auf in diesem Augenblick, weil er niemals etwas sagte, das er später bereute, weil er immer mit einem großen wissenden Auge auf sich selbst und sein Reden herabblickte und selten das Falsche sagte, obgleich er dazu Grund hätte. Diese seine große Gerechtigkeit. Seine großartige Selbstgerechtigkeit.
Plötzlich hatte sie die Befürchtung, losweinen zu müssen, was unter keinen Umständen vor Alfredo geschehen durfte. Also wünschte sie schnell eine gute Nacht, meinte es aber nicht so, meinte eher: Rette mich, Idiot , drehte sich um und stieg mit schnellen lauten Schritten die Wendeltreppe hinauf.
Oben zerrte sie ihr Bettzeug aus dem Schlafzimmer, räumte es auf die kleine Couch im Gästezimmer. Dort saß sie lange Zeit und hörte, wie sich unten Paola und Sergio diskret verabschiedeten, wie sie ihren alten Cinquecento starteten, der sogar auf Anhieb ansprang, als ahnte er, dass man von hier möglichst schnell verschwinden musste, hörte, wie Alfredo nach nebenan ging, wie er die Tür hinter sich schloss und dann nichts mehr. Nur das entfernte Motorengeräusch einer Vespa dann und wann, die Bewegungen und Arbeitsgeräusche ihres eigenen Körpers, das leise surrende, gluckernde, klickende Betriebsgeräusch von Betty Morgenthal, auf der Gästecouch sitzend, und tatsächlich kam sie sich vor wie ein Gast und wäre am liebsten nach Hause gegangen.
Am nächsten Tag verließ sie ohne Alfredos Frühstück die Wohnung. Noch bevor die Kollegen zur Tagschicht eintrafen, stieß sie im Internet auf die Seite des mare-Quartetts, das» Worldjazz mit einer Klangsprache verbindet, die vom experimentellen Jazz inspiriert ist«, wie es geschrieben stand, und fand Toms Telefonnummer und notierte sie auf einen kleinen Zettel, den sie in die Brusttasche ihres Kittels steckte. Am Nachmittag, als alle beim Essen saßen, ging sie zu dem alten weißen Telefon im Assistentenzimmer, bei dem man sich stets wunderte, dass es tatsächlich funktionierte, und wählte. Bevor es tutete, legte sie auf. Sie atmete tief. Dann nahm sie den Hörer erneut in die Hand, wählte, weit hinter den Alpen klingelte es viermal. Dann übernahm der Anrufbeantworter, eine Frauenstimme, Betty hörte nicht, was sie sagte, der lange Pfeifton, und sie begann zu sprechen.
Tom Holler ist eine Schnecke, die auf die andere Seite der Bundesstraße will. Eine entschlossene Schnecke, die jemand aufhebt, in falscher Tierliebe in die Hand nimmt und zurückbringt, auf die andere Seite der Bundesstraße ins grüne saftige Gras setzt, und die Schnecke kann den ganzen Weg noch einmal machen.
Die Schnecke Tom Holler sitzt am Flügel, starrt auf das zerbrochene Glas am Boden, dessen Inhalt sich milchig auf den frisch geputzten Dielen verteilt hat, und wundert sich, dass es gerade Betty Morgenthal gewesen ist, die ihn aufgehoben und auf die andere Seite der Straße gebracht hat. Und jetzt, denkt die Schnecke Tom Holler, muss er schon wieder putzen, obwohl er den Fußboden so sauber geputzt hat, ein letztes Mal, um ihn nie wieder putzen zu müssen, aber das Leben lebt von Wiederholungen, weshalb er wahrscheinlich wird wieder und wieder putzen müssen, was ihn auf einmal erleichtert, denn das Putzen kennt er wenigstens.
Weil er aber keine Lust hat, sofort zu putzen, streckt er seine Hände aus und senkt sie, seit vielen Wochen zum ersten Mal, auf die Tasten hinab. Diese bewegen sich scheinbar ohne sein Zutun, produzieren eine Melodie, an die er sich nur schwach erinnert, seine Finger aber offensichtlich sehr wohl: Es ist eine Achtelbewegung in Moll, ein langsames Schreiten in beiden Händen, das er wiederholt, bis er weiß, wo es langgeht, und die Melodielinie aus dem Nichts kommt, ein leuchtendes Herbstblatt oder ein weggeworfenes Stück Papier, das von einer Windböe aufgehoben und in immer dramatischere Höhen getragen wird, ein Lied offenbar für Gesang und Klavier, ein spätromantisches Stück, Schubert, nein, Schumann, und dann kommt auch der Text,»du bist vom Schlaf erstanden«, Textlücke, er summt die Melodie, was sich nicht schön anhört, und wieder rinnen Tränen über sein Gesicht, obwohl er doch nicht eigentlich weint, obwohl sein Mund nicht bebt, kein Schluchzen, nichts, nur ist da diese Nässe in seinem Gesicht, die an seinem Hals hinab in den Hemdkragen rinnt, an seiner Brust entlang, während er spielt und summt, auch singt ab und zu, wenn er in der Abstellkammer seines Gedächtnisses über eine Zeile stolpert, die zu diesem Lied gehört haben könnte,»und morgens dann ihr meinet/stets fröhlich sei sein Herz«.
Er zieht seine Hände von den Tasten zurück, als hätte er sich die Finger verbrannt, schließt die Klappe, die hart auf dem Holz aufschlägt. Es ist ihm peinlich, er ist sich selbst peinlich, wie er am Flügel sitzt, nicht heulend, aber doch aus irgendeinem Grund mit tränenüberströmtem Gesicht, durchnässtem Hemdkragen, aber erleichtert, und doch in der Verpflichtung zu putzen, nach wie vor.
Er hat dieses Lied mit Betty Morgenthal gespielt.»Stille Tränen «für hohe Stimme und Klavierbegleitung, er weiß es wieder, er hat es die ganze Zeit gewusst, hatte es nur zu gut versteckt in seinem Gedächtnis, wie jenen kreisrunden grünen Edelstein, den er als Kind bei einem verregneten Sommerurlaub am Strand gefunden und Jahre später nach seinem Umzug nach Berlin auf dem Unterboden des Klaviers zufällig wiederentdeckt hatte, worauf er erkannte, dass der Stein keineswegs wertvoll, sondern ein von Meeresbrandung abgeschliffenes Stück Flaschenglas war.
Das Lied hat er in den Händen. Betty Morgenthal in seinem Kopf.
Sie steht jetzt darin im beigefarbenen Schlaf-T-Shirt. Lehnt im Türrahmen, ein Bein angewinkelt am Türstock, Arme vor der Brust verschränkt. Ihr Haar, vom Schlaf zerzaust. Kennermiene mit leicht geschürztem Mund, gehobenen Brauen, Blickrichtung auf die vergilbten Rillen der Wohnzimmertapete, in denen sich die Musik zu fangen scheint. So steht sie und verfolgt jede einzelne Note der Klavierexposition, die er sehr leise spielt, weil es frühmorgens ist und er Betty und Marc nicht wecken möchte. Es ist Sonntag. Berliner Winter vor dem Fenster, ein weißer Himmel wie heute, der pergamentartig bis auf die Konturen der Häuser hinabhängt, und seine Hände, erinnert er sich, sind gefroren, rot, tauen nur langsam auf, während er spielt und Betty ins Zimmer tritt und ihr Sopran sich in die Musik schleicht, kaum hörbar zunächst, vorsichtig, als klopfe sie an. Und dann hebt ein Kran oder Ähnliches sie langsam bis zu jenem traurigsten Höhepunkt, jenem endlosen Seufzer, auf den das ganze Lied hin steigt, während es gleichzeitig, wie gespiegelt, in immer tiefere Dunkelheit sinkt.»In stillen Nächten weinet /oft mancher aus dem Schmerz /und morgens dann ihr meinet /stets fröhlich sei sein Herz.«
Читать дальше