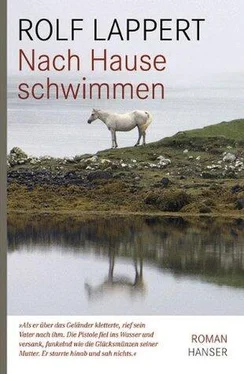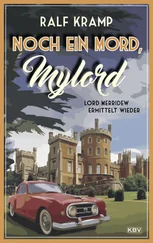«Roger mit den Zeitungsausschnitten?«Ich sehe Aimee an.
«Vor fünf Tagen«, sagt sie leise.»Er hat sich zur Arbeit im Schwimmbad gemeldet, nur um an das Gift ranzukommen.«
Ich bringe keinen Ton hervor. Roger hat sich umgebracht. Er und seine Familie gehörten zu den Bewohnern eines kleinen Ortes in Tennessee, deren Leben durch einen Chemiekonzern zerstört worden waren. Ihr elfjähriger Sohn starb an Leukämie, wenige Wochen nachdem ein Gericht den Betroffenen Wiedergutmachungsgeld zugesprochen hatte. Die Firma schloss die Niederlassung in Tennessee und ließ in dem Ort drei Todesopfer und mehr als zweihundert entlassene Arbeiter zurück. Ein paar Verantwortliche gingen für kurze Zeit ins Gefängnis. Roger benutzte das Geld, um die Umweltverbrechen anderer Firmen aufzudecken. Seine Frau nahm ihren Anteil und ließ sich von ihm scheiden. Roger verkaufte das Haus, reiste durch das Land und half beim Aufbau von Bürgerinitiativen, die gegen fahrlässig handelnde Konzerne prozessierten und meistens verloren. Er hielt Reden vor zwanzig und zweihundert Leuten und schrieb Artikel, er gab Lokalzeitungen Interviews und saß in winzigen Radiostudios, er bezahlte Rechtsanwälte und wohnte in billigen Motels, er vergaß zu schlafen und zu essen und begann zu trinken. Zwei Jahre lang schaffte er es, keine Zeit zum Trauern um seinen Sohn zu haben. Als das Geld und das Interesse der Medien an seiner Mission versiegt waren, hängte er sich mit seinem Gürtel an ein Wasserrohr in der Waschküche eines Motels. Er war bewusstlos, als die Halterungen des Rohrs aus der Decke brachen. Das Journey’s End Motel lag am Ortsrand von Bloomington, New York. Von dort war es nicht sehr weit bis zu Vermeers luxuriösem Auffanglager.
Das alles habe ich aus den Artikeln, die Roger mir stumm vor die Füße gestellt hatte, den Rest von Melvin.
«Der Artikel ist fast fertig«, sagt Aimee.»Ich dachte, vielleicht liest du ihn mal. Wir könnten darüber reden, und du sagst mir, ob noch was fehlt.«
«Ich glaube nicht«, sage ich nach einer Weile. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was Aimee gesagt hat. Ich habe mich gefragt, ob Roger jetzt bei seinem Sohn ist. Ob es tatsächlich einen Himmel gibt, wo alle einander wiedersehen. Und ob meine Mutter und Orla da oben auf mich warten, egal, wie lange es dauert. Als Kind lag ich nächtelang wach und stellte mir diese Fragen. Ob es ein Jenseits gibt, oder ob das bloß eine Erfindung der Kirche ist, ein falsches Versprechen, eine Lüge, damit wir das Diesseits ertragen. Aimee redet, ihre Stimme ist weit weg, und ich frage mich, ob Roger im Paradies ist oder einfach nur tot, zurück im Nichts, erlöst von allem Schmerz.
«Was Vermeer und die Ärzte da tun, ist illegal«, sagt Aimee. Sie spricht lauter, weil sie weiß, dass ich ihr nicht zuhören will.»Pingpong statt Psychopharmaka klingt schön, aber es ist unverantwortlich. Wir reden hier nicht von Männern mit kleinen Nervenzusammenbrüchen. Ihr habt versucht, euch umzubringen, Herrgott!«
Ich will ihr noch einmal sagen, dass ich mich nicht umbringen wollte, lasse es dann aber bleiben. Plötzlich bin ich sehr müde.»Man hat sich gut um mich gekümmert. Ich habe Medikamente bekommen.«
«Auf der Krankenstation, ja. Schlaftabletten. Beruhigungspillen.«»Ich konnte mich erholen.«
Die alten Leute bezahlen, verwandeln sich zurück in die Gruppe glückloser Jäger und gehen. Jemand dreht die Musik lauter, die Töne eines Klaviers vermischen sich mit dem gelben Licht. Aimee streift sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. Eine Weile scheint es, als höre sie der Musik zu. Ich trinke meinen Tee, der inzwischen lauwarm ist.
«Es wäre schön, wenn du mir helfen würdest«, sagt Aimee leise.
«Ich habe nichts gegen Vermeer«, sage ich ruhig.»Dafür, dass er mich nicht mit irgendwelchem antidepressiven Mist vollgestopft hat, bin ich ihm sogar dankbar.«
«Du hast einen Spiegel zertrümmert, um dir die Pulsadern aufzuschlitzen, verdammt noch mal!«Aimee sagt das so laut, dass die drei Männer und die Kellnerin zu uns herübersehen.
Ich stehe auf und gehe. Mir ist ein wenig schwindlig, vielleicht weil ich heute noch nichts gegessen habe. Auf dem Weg zum Hotel werde ich Brot und Schokolade kaufen. Aimee ruft mir nicht nach und folgt mir nicht.
Heute habe ich fast die Hälfte meines Wochenlohns für einen gebrauchten Föhn und einen kleinen Elektroofen ausgegeben. Weil Winston mich mag, hat er noch einen tragbaren Schwarzweißfernseher und einen Bambusstab in die Kiste getan. Der Bambusstab ersetzt die Fernbedienung. Mit ihm drücke ich die Programmtaste und verschiebe den Lautstärkeregler. Das Gerät hat die Größe und technische Raffinesse eines Toasters. Das Bild ist entweder zu hell oder zu dunkel, und zittrige Linien wabern von oben nach unten, was aussieht, als würden Schlieren von Flüssigkeit über den Bildschirm laufen. Der Ton ist in Ordnung, und die meiste Zeit liege ich mit geschlossenen Augen da und höre einfach nur zu. Vom Ofen geht ein seltsamer, metallischer Geruch aus, aber er schafft es immerhin, den winzigen Raum zu erwärmen.
Später sehe ich mir Twelve Monkeys an. Ich kenne den Film schon, aber in Schwarzweiß und Postkartengröße ist es ein neues Erlebnis. Flimmernd und ohne den Trost der Farben wirken die Bilder noch düsterer, die Geschichte verliert selbst den letzten Funken Hoffnung. Ich liege auf dem Bauch, meine Nase berührt beinahe den warmen Bildschirm. Ich krieche unter die Erde zu den Überlebenden, ich folge Bruce Willis in die Vergangenheit, ich bin James Cole, der im falschen Jahr landet, neunzehnhundertneunzig, dem Jahr, in dem Orla starb.
Ich liege auf den Steinen, dem Turm im Meer aus Gras. Über mir sind Sterne. Mein Großvater kniet neben mir. Das Messer in seiner Hand schimmert im Licht des Mondes. Er hat Gott gerufen, aber die Stille um uns ist nicht nur die meines Traums. Er wollte uns erlösen, alles Unrecht sühnen, jetzt verliert sich sein Blick im Leuchten der Klinge. Ich spüre mich nicht. Ich bin ein Name in einem alten Heft, eine Skizze, ich liege zwischen den Zeilen, umgeben von Wörtern ohne Sinn. Mein Körper ist ein zittriger Kreis, meine Haut aus Tinte. Das Papier schluckt mich, es weht mich davon, an den Rändern glühend. Mein Großvater weint, und ich will meine Hand auf seine legen, aber ich bin schon fort. Der Wind treibt mich aufs Meer, im Wasser bekomme ich einen Leib und sinke schwer zum Grund. Die Fische rufen meinen Namen.
«Wilbur.«
Das Wasser ist getränkt von Helligkeit, Mondlicht trägt mich. Ich muss atmen, in meinen Lungen kreist singend ein Rest verdorbener Luft. Meine Arme rudern, unter meinen Füßen ist nichts, nicht einmal das Muster aus schwarzen Namen. Fische schwimmen durch mich hindurch.
«Wilbur?«
Mein Kopf stößt durch die Oberfläche in die Dunkelheit. Klopfen dringt an mein Ohr. Ich öffne den Mund und schlucke warmen Sauerstoff. Ich huste, richte mich auf und starre keuchend auf die Wand vor mir. Langsam heben sich die Dinge aus dem Dunkel, der Schrank, der Stuhl.
«Wilbur, bitte mach auf. «Wieder das Klopfen.
Ich stehe auf, es ist ein halber Schritt zur Tür. Aimee steht auf dem Flur, breit und schwarz in ihrem Mantel. Wir sehen uns an, das Spiel ist zu Ende.
«Eine Katze«, sagt Aimee nach einer Weile. Hinter ihrem Kopf brennt ein Licht, ihre Haare leuchten. Sie riecht nach Regen und U-Bahn und Dieselwolken.
«Was?«Meine Stimme ist leise, ich räuspere mich.
«Die Narbe. Ich habe mit der Katze des Nachbarn gespielt.«
Ich nicke, dann erst begreife ich. Der rosafarbene Halbmond auf ihrer Wange. Aus einem der Zimmer dringt Musik, jemand flucht. Der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung, und ich spüre den Ruck durch die nackten Fußsohlen.
«Lässt du mich rein?«
Ich trete zur Seite, und sie kommt zu mir ins Zimmer. Ihr Haar streift mich beinahe. Erst jetzt sehe ich, dass sie in der Hand meinen Koffer trägt.
Читать дальше