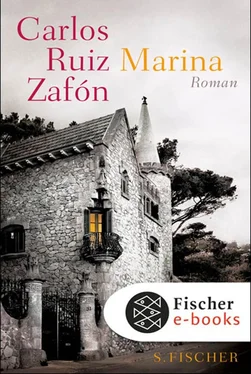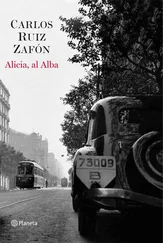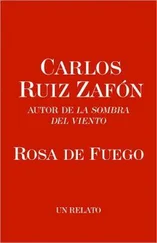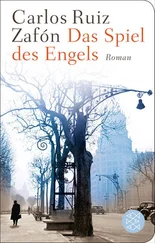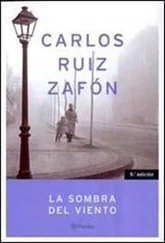»Und wann?«
Ich schaute auf die Uhr.
»In rund vierzig Minuten.«
Mit der U-Bahn fuhren wir zur Plaza de Cataluña. Es wurde bereits dunkel, als wir die Treppe zu den Ramblas hinaufstiegen. Weihnachten lag vor der Tür und die Stadt im Glanz der Lichtergirlanden. Die Straßenlaternen zeichneten bunte Muster auf den Boulevard. Zwischen Blumenkiosken und Cafés flatterten Taubenschwärme, es wimmelte von Straßenmusikanten und Animierdamen, Touristen und Provinzlern, Polizisten und Gaunern, Bürgern und Gespenstern aus anderen Zeiten. Germán hatte recht – nirgends sonst auf der Welt gab es eine solche Straße.
Vor uns erhob sich die Silhouette des Liceo-Theaters. Es war ein Abend mit Operngala, und das Lichterdiadem des Vordachs war an. Auf der anderen Seite des Boulevards erkannten wir an einer Ecke der Fassade den grünen Drachen des Fotos, der die Menge betrachtete. Bei seinem Anblick dachte ich, die Geschichte habe die Altäre und Farbbildchen für den heiligen Georg reserviert, dem Drachen aber sei auf ewig Barcelona zugefallen.
Dr. Shelleys ehemalige Praxis belegte den ersten Stock eines herrschaftlichen Hauses mit düsterer Beleuchtung. Wir durchquerten ein höhlenartiges Entree, von dem aus in einer Spirale eine gewundene Treppe hinaufführte. Unsere Schritte verloren sich im Echo des Treppenhauses. Die Türklopfer waren schmiedeeiserne Engelsgesichter. Kathedralenartige Dachfenster umgaben das Oberlicht und machten das Haus zum größten Kaleidoskop der Welt. Der erste Stock war, wie immer bei Häusern jener Zeit, nicht der erste, sondern der dritte – nach Hochparterre und Hauptstock gelangten wir zu der Tür, auf der ein altes Bronzeschild verkündete: Dr. Joan Shelley . Ich schaute auf die Uhr. Es fehlten noch zwei Minuten bis zu der vereinbarten Zeit, als Marina anklopfte.
Zweifellos war die Frau, die uns öffnete, einem Heiligenbild entsprungen. Ungreifbar, jungfräulich und von einem mystischen Hauch umgeben. Ihre Haut war schneeweiß, beinahe durchsichtig und ihre Augen hell bis zur Farblosigkeit. Ein Engel ohne Flügel.
»Señora Shelley?«, fragte ich wohlerzogen.
Sie nickte, und ihr Blick glühte vor Neugier.
»Guten Abend«, setzte ich an.»Mein Name ist Óscar. Ich habe heute Vormittag mit Ihnen gesprochen.«
»Ich weiß. Kommen Sie, kommen Sie.«
Nachdem wir eingetreten waren, bewegte sie sich wie eine Tänzerin auf Wolken, im Zeitlupentempo. Sie war von fragilem Körperbau und roch nach Rosenwasser. Ich schätzte sie auf etwas über dreißig, obwohl sie jünger wirkte. Eines ihrer Handgelenke war verbunden, und um den Schwanenhals trug sie ein Tüchlein. Die Diele war eine mit Samt und Rauchglasspiegeln ausgekleidete Dunkelkammer. Die Wohnung roch nach Museum, als wäre die Luft schon seit Jahrzehnten darin gefangen.
»Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns empfangen. Das ist meine Freundin Marina.«
María fasste Marina ins Auge. Immer schon hat mich fasziniert, wie Frauen einander mustern. Das hier war keine Ausnahme.
»Erfreut«, sagte María Shelley schließlich gedehnt.»Mein Vater ist ein Mann fortgeschrittenen Alters mit ein wenig flatterhaftem Temperament. Bitte ermüden Sie ihn nicht.«
»Seien Sie unbesorgt«, sagte Marina.
Sie bat uns herein. Sie bewegte sich tatsächlich mit luftiger Elastizität.
»Und Sie sagen, Sie haben etwas, was dem verstorbenen Señor Kolwenik gehörte?«, fragte María.
»Haben Sie ihn denn gekannt?«, fragte ich meinerseits.
Bei den Erinnerungen an frühere Zeiten leuchtete ihr Gesicht auf.
»Nicht wirklich, nein… Ich habe aber viel von ihm gehört. Als Mädchen«, fügte sie wie für sich selbst hinzu.
Die mit schwarzem Samt ausgeschlagenen Wände waren von Heiligen-, Muttergottes- und Märtyrerbildchen bedeckt, Letztere im Todeskampf. Die dunklen Teppiche absorbierten das bisschen Licht, das zu den Ritzen der geschlossenen Fenster hereindrang. Während wir unserer Gastgeberin durch diese Galerie folgten, fragte ich mich, wie lange sie hier schon allein mit ihrem Vater leben mochte. Ob sie je geheiratet und außerhalb der bedrückenden Welt dieser Wände irgendetwas erlebt, geliebt oder gefühlt hatte?
Vor einer Schiebetür blieb María Shelley stehen und klopfte an.
»Vater?«
Dr. Joan Shelley bzw. das, was von ihm übriggeblieben war, saß unter mehreren Decken in einem Sessel vor dem Feuer. Seine Tochter ließ uns mit ihm allein. Ich versuchte, meine Augen von ihrer Wespentaille abzuwenden, während sie sich zurückzog. Der greise Arzt, in dem ich kaum den Mann wiedererkannte, dessen Foto ich in der Tasche hatte, betrachtete uns schweigend. Seine Augen verrieten Argwohn. Eine seiner Hände zitterte leicht auf der Sessellehne. Unter einer Maske von Kölnischwasser stank sein Körper nach Krankheit. Sein sarkastisches Lächeln konnte das Unbehagen nicht übertünchen, das ihm die Welt und sein eigener Zustand einflößten.
»Die Zeit macht mit dem Körper, was die Dummheit mit der Seele macht«, sagte er, auf sich deutend.»Sie lässt ihn vermodern. Was wollen Sie?«
»Wir haben uns gefragt, ob Sie uns von Michail Kolwenik erzählen könnten.«
»Könnte ich schon, aber ich sehe keinen Grund dafür«, sagte der Arzt kurz angebunden.»Seinerzeit ist schon genügend geredet worden, und alles war gelogen. Würden die Leute auch nur ein Viertel so viel denken, wie sie reden, diese Welt wäre ein Paradies.«
»Ja, aber wir sind an der Wahrheit interessiert«, sagte ich.
Der Alte verzog das Gesicht zu einer spöttischen Grimasse.
»Die Wahrheit findet man nicht, mein Junge. Sie findet einen.«
Ich versuchte, gefügig zu lächeln, begann aber zu ahnen, dass dieser Mann tatsächlich nicht im Sinn hatte, seine Zugeknöpftheit aufzugeben. Marina erriet meine Befürchtung und ergriff die Initiative.
»Dr. Shelley«, sagte sie sanft,»zufällig ist uns eine Fotosammlung in die Hände geraten, die Señor Michail Kolwenik gehört haben könnte. Auf einem dieser Bilder sind Sie mit einem Ihrer Patienten zu sehen. Aus diesem Grund haben wir es gewagt, Sie zu belästigen, in der Hoffnung, die Sammlung ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben.«
Diesmal gab es keinen lapidaren Satz zur Antwort. Der Arzt betrachtete Marina, ohne eine gewisse Überraschung zu verbergen. Ich fragte mich, warum mir keine solche List eingefallen war, und dachte, je mehr Marina die Last des Gesprächs übernehme, desto besser.
»Ich weiß nicht, von was für Fotografien Sie sprechen.«
»Es ist ein Archiv, das von Missbildungen betroffene Patienten zeigt«, sagte sie.
In den Augen des Arztes leuchtete es auf. Wir hatten einen Nerv berührt. Unter den Decken gab es also doch Leben.
»Was bringt Sie auf den Gedanken, diese Sammlung könnte Michail Kolwenik gehört haben?«, fragte er mit gespielter Gleichgültigkeit.»Oder ich hätte irgendetwas damit zu tun?«
»Ihre Tochter hat uns gesagt, Sie beide seien Freunde gewesen«, sagte Marina, vom Thema abweichend.
»María hat die Tugend der Naivität«, unterbrach Shelley sie feindselig.
Marina nickte, stand auf und gab mir ein Zeichen, es ihr gleichzutun.
»Ich verstehe«, sagte sie höflich.»Wir müssen uns geirrt haben. Tut uns leid, Sie belästigt zu haben, Doktor. Gehen wir, Óscar. Wir werden schon herausfinden, wem wir die Sammlung geben müssen.«
»Einen Augenblick.«
Shelley räusperte sich und bedeutete uns, wieder Platz zu nehmen.
»Habt ihr diese Sammlung noch?«
Marina nickte und hielt dem Blick des Alten stand. Auf einmal gab Shelley ein Geräusch von sich, das wahrscheinlich Gelächter war, aber klang, als zerknüllte er alte Zeitungsseiten.
»Wie soll ich wissen, dass ihr die Wahrheit sagt?«
Marina warf mir einen stummen Befehl zu. Ich zog das Foto aus der Tasche und reichte es ihm. Er ergriff es mit seiner zitternden Hand und studierte es ausgiebig. Schließlich wandte er den Blick zum Feuer und begann zu sprechen.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу