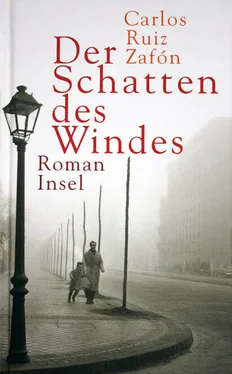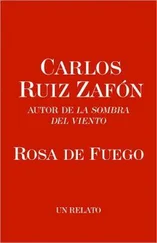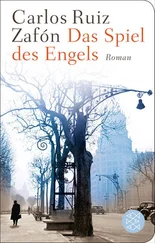Sophie Carax hatte nie gedacht, daß sie Don Ricardo nach Jahren wiedersehen würde (nun ein reifer Mann, Vorsteher des Familienimperiums und Vater von zwei Kindern) und daß er zurückkäme, um den Sohn kennenzulernen, den er für fünfhundert Peseten hatte verschwinden lassen wollen.
In Jorge, seinem Erstgeborenen, vermochte er nicht sich selbst zu sehen. Der Junge war schwach, zurückhaltend und entbehrte der geistigen Präsenz des Vaters. Es fehlte ihm an allem, außer am Namen. Eines Tages war Don Ricardo im Bett eines Dienstmädchens mit dem Gefühl erwacht, sein Körper werde alt, Venus habe ihm ihre Gnade entzogen. Von Panik befallen, eilte er zum Spiegel, und als er sich nackt darin betrachtete, hatte er den Eindruck, belogen zu werden. Das war doch nicht er.
Da wollte er den Mann wiederfinden, den man ihm genommen hatte. Seit Jahren wußte er um den Sohn des Hutmachers. Auch Sophie hatte er auf seine Weise nicht vergessen. Als der Moment gekommen war, beschloß er, den Jungen kennenzulernen. Zum ersten Mal in fünfzehn Jahren traf er auf jemanden, der ihn nicht fürchtete, sondern ihn herauszufordern, ja sich über ihn lustig zu machen wagte. Er erkannte in ihm die Männlichkeit, den stillen Ehrgeiz, den die Narren nicht sehen, der aber im Innern brennt. Sophie, ein fernes Echo der Frau, an die er sich erinnerte, hatte nicht einmal mehr die Kraft einzuschreiten. Der Hutmacher war bloß ein Hanswurst, ein boshafter, nachtragender Tölpel, dessen Komplizenschaft ihm als gegeben galt. Er wollte Julián aus dieser unerträglich mittelmäßigen, ärmlichen Welt herausnehmen, um ihm die Tore zu seinem Finanzparadies zu öffnen. Er sollte in der San-Gabriel-Schule unterrichtet werden, sämtliche Privilegien seiner Klasse genießen und in die Wege eingeweiht werden, die er, sein Vater, für ihn ausgesucht hatte. Don Ricardo wollte einen würdigen Nachfolger. Jorge würde immer im Schatten seiner Vorrechte leben, verhätschelt und zum Scheitern verurteilt. Penélope, die reizende Penélope, war eine Frau und als solche ein Schatz, keine Schatzmeisterin. Julián, der eine unergründliche und also eine mörderische Fantasie hatte, vereinigte in sich die nötigen Eigenschaften. Es war nur eine Frage der Zeit. Don Ricardo rechnete sich aus, daß er sich innerhalb von zehn Jahren in dem Jungen selbst herausgemeißelt hätte. Niemals in der ganzen Zeit, die Julián bei den Aldayas verbrachte, und zwar als einer ihresgleichen, ja als der Auserwählte, fiel ihm ein, der Junge könnte gar nichts von ihm wollen — außer Penélope. Nicht einen Augenblick kam er auf den Gedanken, daß ihn Julián insgeheim verachtete und daß diese ganze Farce für ihn nichts weiter als ein Vorwand war, um in Penélopes Nähe zu sein, um sie mit Haut und Haaren zu besitzen. Darin glichen sie sich tatsächlich.
Als ihm seine Frau berichtete, sie habe Julián und Penélope in einer eindeutigen Situation gesehen, ging für ihn die Welt in Flammen auf. Der Schrecken und der Verrat, die unsägliche Wut, in seinem eigenen Spiel an der Nase herumgeführt und von dem betrogen worden zu sein, den er aufs Podest zu heben gelernt hatte wie sich selbst — das alles stürmte so mächtig auf ihn ein, daß niemand seine Reaktion verstehen konnte. Als der Arzt, der Penélope untersuchen kam, bestätigte, daß sie entjungfert worden war, spürte Don Ricardo Aldaya nur noch blinden Haß. Der Tag, an dem er Penélope im Zimmer des dritten Stocks einzuschließen befahl, war auch der Tag, an dem sein Niedergang einsetzte. Alles, was er von da an tat, war nur noch Ausdruck der Selbstzerstörung.
Gemeinsam mit dem Hutmacher, den er so verachtet hatte, beschloß er, Julián von der Bildfläche verschwinden zu lassen und in die Armee zu schicken, wo man seinen Tod als Unfall auszugeben hatte. Niemand, weder Ärzte noch Hausangestellte, noch Familienmitglieder außer ihm und seiner Frau, durfte Penélope besuchen in all den Monaten, in denen sie in diesem Zimmer eingesperrt war. Inzwischen hatten ihm seine Teilhaber hinter seinem Rücken die Unterstützung entzogen und schmiedeten Ränke, um ihm mit genau dem Vermögen, zu dem er ihnen verholfen hatte, die Macht zu entreißen. Aldayas Imperium bröckelte in Geheimsitzungen und in Besprechungen auf Madrider Gängen und in Genfer Banken bereits leise vor sich hin. Wie er hatte annehmen müssen, war Julián entkommen. Im Grunde war er sogar stolz auf den Jungen, selbst wenn er ihm den Tod wünschte — an seiner Stelle hätte er genauso gehandelt. Irgend jemand würde für ihn büßen müssen.
Am 26. September 1919 gebar Penélope Aldaya einen Jungen, der tot zur Welt kam. Hätte ein Arzt sie untersuchen dürfen, so hätte er diagnostiziert, daß das Baby schon seit Tagen in Gefahr war und daß man hätte einschreiten und einen Kaiserschnitt machen müssen. Wäre ein Arzt zugegen gewesen, hätte er vielleicht die Blutung stillen können, die Penélopes Leben ein Ende setzte. Wäre ein Arzt zugegen gewesen, hätte er Don Ricardo Aldaya des Mordes bezichtigt. Doch da war niemand, und als man schließlich die Tür öffnete und Penélope fand, tot in einer Lache ihres Blutes liegend und ein purpurnes, glänzendes Baby in den Armen, brachte keiner einen Laut heraus. Ohne Zeugen und Zeremonie wurden die beiden Leichen in der Krypta im Keller begraben, Laken und sonstige Überbleibsel in den Heizkessel geworfen und das Zimmer mit Pflastersteinen zugemauert.
Als Jorge Aldaya, der sich aus Schuldgefühl und Scham betrunken hatte, Miquel Moliner erzählte, was geschehen war, entschloß sich dieser, Julián Penélopes Brief zu schicken, in dem sie erklärte, ihn nicht zu lieben, und ihn mit dem Hinweis auf ihre Heirat bat, sie zu vergessen. Er hielt es für besser, daß Julián diese Lüge glaubte und im Schatten eines Verrats ein neues Leben begann, als ihm die Wahrheit preiszugeben. Zwei Jahre später, als Señora Aldaya starb, wollten einige Leute der Verhexung des Hauses die Schuld daran geben, aber ihr Sohn Jorge wußte, daß die Ursache für ihren Tod das Feuer war, das sie aufzehrte, Penélopes Schreie und ihre verzweifelten Schläge an die Tür, die unablässig in ihr weiterhämmerten. Mittlerweile hatte die Familie alles Ansehen verloren, und das Aldaya-Vermögen zerrieselte wie eine Sandburg. Die engsten Mitarbeiter und der Chefbuchhalter planten die Flucht nach Argentinien, den Anfang eines neuen, bescheideneren Geschäfts. Das einzig Wichtige war, Distanz zu schaffen, Distanz zu den Geistern, die sich in den Gängen des Hauses Aldaya bewegten, die sich darin immer bewegt hatten.
An einem Morgen des Jahres 1926 verließen sie Barcelona unter falschem Namen an Bord des Schiffes, das sie über den Atlantik zum Hafen von La Plata bringen sollte. Jorge und sein Vater teilten die Kabine. Der alte Aldaya, todkrank, konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Die Ärzte, die er nicht zu Penélope gelassen hatte, hatten ihn zu sehr gefürchtet, um ihm die Wahrheit zu sagen, doch er wußte, daß der Tod mit ihnen an Bord gegangen war und daß sein Körper immer mehr verfiel. Als er auf dieser langen Reise auf dem Deck saß, eingemummt und dennoch zitternd und die unendliche Leere des Ozeans vor Augen, wurde ihm klar, daß er das Festland nicht mehr erblicken würde. Manchmal saß er auf dem Hinterdeck und beobachtete den Haifischschwarm, der dem Schiff seit Teneriffa folgte. Er hörte einen der Offiziere sagen, dieses Gefolge sei normal bei Überseekreuzern, die Tiere ernährten sich von den Abfällen, die das Schiff zurücklasse. Doch Don Ricardo Aldaya glaubte es nicht. Er war überzeugt, diese Teufel verfolgten ihn. Ihr wartet auf mich, dachte er, der in ihnen das wahre Antlitz Gottes sah. Da ließ er seinen Sohn Jorge, den er so oft mit Verachtung gestraft hatte und der jetzt seine einzige Zuflucht geblieben war, schwören, seinen Letzten Willen zu erfüllen.
»Du wirst Julián Carax finden und ihn töten. Schwöre es mir.«
Читать дальше