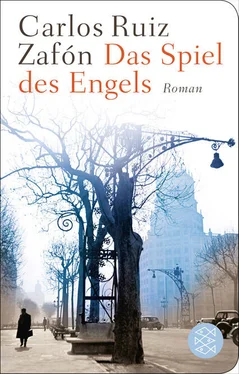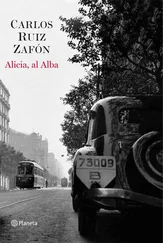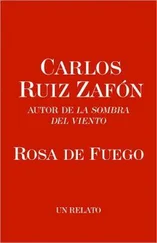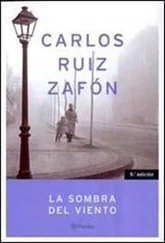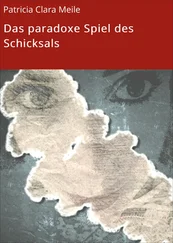»Sagen Sie es mir.«
Er deutete ein Lächeln an, wie ein guter Spieler.
»Die Schwester sagt mir, sie seien Schriftsteller, obwohl ich hier sehe, dass Sie beim Ausfüllen des Fragebogens Söldner angegeben haben.«
»In meinem Fall gibt es da keinen Unterschied.«
»Ich glaube, einer meiner Patienten ist einer ihrer Leser.«
»Hoffentlich ist der dadurch entstandene Nervenschaden kein bleibender.«
Der Arzt lächelte, als amüsierte ihn meine Bemerkung, und setzte dann eine ernstere Miene auf, um mir zu verstehen zu geben, die freundlich dahinplätschernden Vorreden seien zu Ende.
»Señor Martín, ich sehe, dass Sie allein gekommen sind. Haben Sie keine direkten Angehörigen? Frau? Geschwister? Eltern, die noch leben?«
»Das klingt ziemlich düster.«
»Ich will Sie nicht belügen, Señor Martín. Die ersten Testergebnisse sind nicht ganz so vielversprechend, wie wir erwartet haben.«
Ich schaute ihn schweigend an. Ich empfand weder Angst noch Sorge. Ich empfand gar nichts.
»Alles weist darauf hin, dass Sie in der linken Hirnhälfte eine Wucherung haben. Die Ergebnisse bestätigen, was die von Ihnen beschriebenen Symptome haben befürchten lassen, und alles scheint darauf hinzudeuten, dass es sich um ein Geschwür handeln könnte.«
Einige Augenblicke lang war ich zu keiner Äußerung imstande. Ich konnte nicht einmal Überraschung heucheln.
»Wie lange habe ich das schon?«
»Das lässt sich nicht genau sagen, aber ich würde die Vermutung wagen, dass der Tumor schon recht lange wächst, was auch die genannten Symptome und die Probleme erklären würde, die Sie in letzter Zeit bei der Arbeit gehabt haben.«
Ich nickte und atmete tief. Der Arzt schaute mich geduldig und wohlwollend an und ließ mir Zeit. Ich hob zu mehreren Sätzen an, die mir jedoch nicht über die Lippen wollten. Schließlich trafen sich unsere Blicke.
»Ich nehme an, ich bin in Ihrer Hand, Doktor. Sie werden mir sagen, welcher Behandlung ich mich zu unterziehen habe.«
Nun, da er bemerkte, dass ich ihn offenbar nicht hatte verstehen wollen, sah ich, dass sich seine Augen mit Verzweiflung füllten. Ich nickte abermals und kämpfte gegen die im Hals aufsteigende Übelkeit an. Er schenkte mir aus einem Krug ein Glas Wasser ein, das ich in einem Zug leerte.
»Es gibt keine Behandlung«, sagte ich.
»Doch. Wir können vieles tun, um die Schmerzen zu lindern und Ihnen größtmögliches Wohlbefinden und Ruhe zu garantieren…«
»Aber ich werde sterben.«
»Ja.«
»Bald.«
»Möglicherweise.«
Ich musste lächeln. Selbst die schlechtesten Nachrichten haben etwas Erleichterndes, wenn sie nichts weiter bestätigen als das, was man uneingestanden bereits ahnte.
»Ich bin achtundzwanzig«, sagte ich, ohne recht zu wissen, warum.
»Es tut mir leid, Señor Martín. Ich würde Ihnen gern einen besseren Bescheid geben.«
Ich fühlte mich, als hätte ich endlich eine Lüge oder eine lässliche Sünde gestanden und als wäre die steinerne Last der Gewissensbisse mit einem Federstrich weggewischt.
»Wie viel Zeit habe ich noch?«
»Das ist schwer zu sagen. Vielleicht ein Jahr, höchstens anderthalb.«
Sein Ton gab deutlich zu verstehen, dass das eine mehr als optimistische Prognose war.
»Und von diesem Jahr oder was es auch sein mag, wie lange, glauben Sie, werde ich noch arbeiten können und allein zurechtkommen?«
»Sie sind Schriftsteller und arbeiten mit dem Kopf. Leider ist das Problem genau da angesiedelt, und darum ist mit Einschränkungen zu rechnen.«
»Einschränkungen ist kein medizinischer Begriff, Doktor.«
»Normalerweise zeigen sich die Symptome, unter denen Sie leiden, desto intensiver und häufiger, je weiter die Krankheit fortschreitet, und irgendwann werden Sie sich zur Pflege in ein Krankenhaus begeben müssen, damit wir uns um Sie kümmern können.«
»Ich werde nicht mehr schreiben können.«
»Sie werden nicht einmal ans Schreiben denken können.«
»Wie lange noch?«
»Ich weiß es nicht. Neun oder zehn Monate. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Es tut mir sehr leid, Señor Martín.«
Ich nickte und stand auf. Meine Hände zitterten, und ich bekam keine Luft.
»Señor Martín, ich verstehe, dass Sie Zeit brauchen, um das alles zu verarbeiten, aber es ist wichtig, dass wir so rasch wie möglich Maßnahmen ergreifen…«
»Ich darf noch nicht sterben, Doktor. Noch nicht. Ich habe noch etwas zu erledigen. Danach werde ich das ganze Leben zum Sterben haben.«
Am selben Abend ging ich im Turm ins Arbeitszimmer hinauf und setzte mich an die Schreibmaschine, obwohl ich mich völlig hohl fühlte. Die Fenster standen weit offen, aber Barcelona wollte mir nichts mehr erzählen, und ich war unfähig, eine einzige Seite zu füllen. Alles, was ich heraufbeschwören konnte, erschien mir banal und leer. Ich brauchte meine Worte nur nochmals zu lesen, um zu sehen, dass sie kaum das Farbband wert waren. Ich hörte die Musik nicht mehr, die ein passables Stück Prosa aussendet. Nach und nach tröpfelten Andreas Corellis Worte wie ein langsames, wohltuendes Gift in mein Denken.
Es fehlten mir noch mindestens hundert Seiten, um diese x-te Folge der verschrobenen Abenteuer abzuschließen, mit denen sich Barrido und Escobillas eine goldene Nase verdient hatten, aber in diesem Moment wurde mir klar, dass ich sie nicht beenden würde. Ignatius B. Samson war erschöpft auf den Gleisen vor der Straßenbahn liegen geblieben, er hatte sich auf allzu vielen Seiten ausgeblutet, die nie das Licht der Welt hätten erblicken dürfen. Aber bevor er abgetreten war, hatte er mir noch seinen Letzten Willen diktiert: Ich sollte ihn ohne Förmlichkeiten bestatten und ein einziges Mal im Leben zu meiner eigenen Stimme stehen. Er vermachte mir sein beträchtliches Arsenal an Rauch und Spiegeln. Und bat mich, ihn zu entlassen, er sei dazu geboren, in Vergessenheit zu geraten.
Ich raffte die bereits geschriebenen Seiten seines letzten Romans zusammen und steckte sie in Brand. Dabei spürte ich, wie mir mit jeder Seite, die ich den Flammen übergab, ein Stein vom Herzen fiel. An diesem Abend wehte eine feuchtwarme Brise über die Dächer, kam durch mein Fenster herein und trug Ignatius B. Samsons Asche mit sich hinaus, um sie in den Gassen der Altstadt zu verstreuen, damit Ignatius B. Samson dort immer wohne, obwohl seine Worte für immer verstummten und sein Name dem Gedächtnis selbst seiner treusten Leser entfiel.
Am nächsten Tag wurde ich bei Barrido und Escobillas vorstellig. Die Empfangsdame war neu, irgend so ein Fräulein, das mich nicht erkannte.
»Ihr Name?«
»Hugo, Víctor.«
Sie lächelte und stöpselte an der Telefonzentrale, um Herminia zu benachrichtigen.
»Doña Herminia, Don Víctor Hugo ist da und möchte Señor Barrido sprechen.«
Sie nickte und beendete die Verbindung.
»Sie sagt, sie kommt sofort.«
»Arbeitest du schon lange hier?«, fragte ich.
»Eine Woche«, antwortete sie beflissen.
Wenn meine Berechnungen stimmten, war das die achte Empfangsdame, die Barrido und Escobillas in jenem Jahr beschäftigten. Die Angestellten, die direkt der verschlagenen Herminia unterstellt waren, konnten sich immer nur kurze Zeit halten, denn wenn die Giftige entdeckte, dass sie im Gegensatz zu ihr bis vier zählen konnten, befürchtete sie, von ihnen in den Schatten gestellt zu werden, was in neun von zehn Fällen auch geschah, und beschuldigte sie des Diebstahls, der Unterschlagung oder sonst einer unsinnigen Verfehlung. Sie setzte Himmel und Hölle in Bewegung, bis Escobillas ihnen den Laufpass gab und drohte, ihnen einen Meuchelmörder auf den Hals zu hetzen, sollten sie ihre Zunge nicht im Zaum halten.
»Wie schön, dich zu sehen, David«, sagte die Giftige. »Du siehst besser aus, sehr gesund.«
Читать дальше