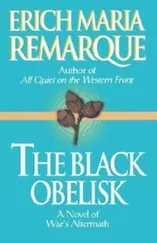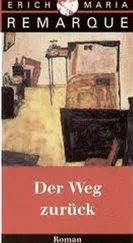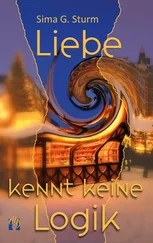Sie blickte auf die Kette der Autos, die unablässig am Quai vorbeiglitt. Fuhr nicht jeder von Brescia nach Brescia? Von Toulouse nach Toulouse? Von Selbstgenügen zu Selbstgenügen? Und von Selbstbetrug zu Selbstbetrug? ich auch! dachte sie. Wahrscheinlich ich auch! Trotz allem! Aber wo ist mein Brescia? Sie blickte auf das Telegramm Hollmanns. Dort, woher es kam, gab es kein Brescia. Weder ein Brescia noch ein Toulouse. Dort gab es nur den lautlosen, unerbittlichen Kampf, den Kampf um Atem an der ewigen Grenze. Dort gab es kein Selbstgenügen und keinen Selbstbetrug. Sie wandte sich ab und ging eine Weile im Zimmer umher. Sie betastete ihre Kleider, und ihr war plötzlich, als riesele Asche in ihnen. Sie hob ihre Bürsten und Kämme auf und legte sie wieder hin, ohne zu wissen, daß sie sie in der Hand gehalten hatte. Was habe ich nur getan? dachte sie. Und was tue ich? Schattenhaft kam durch das Fenster eine Ahnung, als habe sie einen entsetzlichen Irrtum begangen, einen Irrtum, dem nicht auszuweichen gewesen und der jetzt unwiderruflich war.
Sie begann sich anzuziehen für den Abend. Das Telegramm lag noch auf dem Tisch. Im Licht der Lampen schien es heller zu sein als alles andere im Zimmer. Sie blickte von Zeit zu Zeit darauf. Sie hörte das Klatschen des Flusses und roch das Wasser und das Laub der Bäume. Was tun sie jetzt da oben? dachte sie und begann sich zum ersten Male zu erinnern. Was taten sie, während Clerfayt über die dunklen Straßen vor Florenz seinen Scheinwerfern nachraste? Sie zögerte noch eine Weile — dann nahm sie das Telefon auf und sagte die Nummer des Sanatoriums.
»Siena kommt!« schrie Torriani. »Tanken, Reifen wechseln.«
»Wann?«
»In fünf Minuten. Der verdammte Regen!«
Clerfayt verzog das Gesicht. »Wir haben ihn nicht allein. Die andern auch. Pass auf, wo das Depot ist!« Die Häuser mehrten sich. Die Scheinwerfer rissen sie aus dem klatschenden Dunkel. Überall standen Menschen in Regenmänteln und mit Schirmen. Weiße Mauern tauchten auf, Leute, die wegspritzten. Schirme, die wie Pilze im Sturm schwankten, der schleudernde Wagen — »Das Depot!« schrie Torriani.
Die Bremsen fassten, der Wagen schüttelte sich und stand. »Benzin, Wasser, die Reifen, los!« rief Clerfayts in das echohafte Nachhallen nach dem Aufhören des Motors. Es hing in seinen Ohren, als wären sie leere, alte Säle während eines Gewitters.
Jemand gab ihm ein Glas Zitronenwasser und eine neue Brille. »Wo liegen wir?« fragte Torriani.
»Glänzend! An achtzehnter Stelle!«
»Lausig«, sagte Clerfayt. »Wo liegen die andern?«
»Weber an vierter, Marchetii an sechster, Frigerio an siebter Stelle. Conti ist ausgeschieden.«
»Wer liegt an erster Stelle?«
»Sacchetti mit zehn Minuten Vorsprung vor Lotti.«
»Und wir?«
»Neunzehn Minuten Abstand. Habt keine Sorge — wer in Rom der erste ist, gewinnt nie das Rennen. Jeder weiß das!«
Gabrielli, der Rennleiter, stand plötzlich neben ihnen. »Gott hat das so eingerichtet!« erklärte er. »Mutter des Herrn, süßes Blut Christi, du weißt es auch!« betete er. »Strafe Sacchetti, weil er erster ist! Einen kleinen Benzinpumpenbruch, weiter nichts! Und für Lotti auch gleich einen! Ihr Erzengel, beschützt —«
»Wie kommen Sie hierher?« fragte Clerfayt. »Warum warten Sie nicht auf uns in Brescia?«
»Fertig!« schrien die Monteure.
»Los!«
»Warten! Sind Sie verrückt?« begann der Rennleiter. »Ich fliege — « die Worte wurden ihm vom Munde gerissen durch den Motor. Der Wagen raste weg, Menschen stürmten zur Seite, und das Band der Straße, auf das sie geklebt waren, begann wieder seine endlosen Verschlingungen. Was Lillian jetzt tun mag? dachte Clerfayt. Er hatte ein Telegramm nach dem Depot erwartet, er wußte nicht warum, aber Telegramme konnten verzögert werden, und vielleicht lag eines beim nächsten Depot. Dann war wieder die Nacht da, die Lichter, die Menschen, deren Schreie er nicht hörte im Motorbrüllen, als wären sie Figuren aus einem stummen Film, und schließlich nur noch die Straße, diese Schlange, die um die Erde zu laufen schien, und das mystische Tier, das unter der Motorkappe schrie.
Das Gespräch kam sehr rasch. Lillian hat es erst in Stunden erwartet, einmal weil sie das französische Telefon kannte, und dann, weil sie das Gefühl hatte, das Sanatorium sei so weit weg, als läge es auf einem anderen Stern.
»Sanatorium Bella Vista.«
Lillian wußte nicht, ob sie die Stimme kannte. Es konnte sein, daß es immer noch Fräulein Heger war.
»Herrn Hollmann, bitte«, sagte sie und fühlte, wie ihr Herz plötzlich schlug.
»Einen Augenblick.«
Sie lauschte in das fast unhörbare Summen des Drahtes. Es schien, daß man Hollmann suchen mußte. Sie sah auf die Uhr; es war nach dem Abendessen im Sanatorium. Wozu bin ich so erregt, als beschwöre ich einen Toten? dachte sie.
»Hollmann. Wer ist dort?«
Sie erschrak, so klar war die Stimme.
»Lillian«, flüsterte sie.
»Wer?«
»Lillian Dunkerque.«
Hollmann schwieg einen Augenblick. »Lillian«, sagte er dann ungläubig. »Wo sind Sie?«
»In Paris. Ihr Telegramm für Clerfayt kam hierher. Es wurde von seinem Hotel nachgeschickt. Ich habe es aus Versehen geöffnet.«
»Sie sind nicht in Brescia?«
»Nein«, sagte sie und fühlte einen leichten Schmerz.
»Ich bin nicht in Brescia.«
»Wollte Clerfayt es nicht?«
»Nein, er wollte es nicht.«
»Ich sitze am Radio!« sagte Hollmann. »Sie auch, natürlich!«
»Ja, Hollmann.«
»Er fährt großartig. Das Rennen ist noch ganz offen. Ich kenne ihn; er wartet ab. Er läßt die andern ihre Maschinen kaputtfahren. Er wird nicht vor Mitternacht aufdrehen; vielleicht sogar noch etwas später — nein, um Mitternacht, denke ich. Es ist ein Rennen gegen die Uhr, das wissen Sie. Er weiß nie selbst, wo er liegt, das ist das Zermürbende, er erfährt es nur, wenn er Benzin nimmt, und was er hört, ist vielleicht schon überholt. Es ist ein Rennen ins Ungewisse — verstehen Sie mich, Lillian?«
»Ja, Hollmann. Ein Rennen ins Ungewisse. Wie geht es Ihnen?«
»Gut. Die Zeiten sind phantastisch. Durchschnittsgeschwindigkeiten von hundertzwanzig und mehr Kilometern. Dabei kommen viele von den großen Motoren jetzt erst in die langen Geraden. Durchschnittsgeschwindigkeiten, Lillian, keine Höchstgeschwindigkeiten!«
»Ja, Hollmann. Es geht Ihnen gut?«
»Sehr gut. Viel besser, Lillian. Welche Station hören Sie? Nehmen Sie Rom; Rom ist jetzt näher am Rennen als Mailand.«
»Ich habe Rom. Ich freue mich, daß es Ihnen besser geht.«
»Und Sie, Lillian?«
»Sehr gut. Und —«
»Es ist vielleicht richtig, daß Sie nicht in Brescia sind, es stürmt und regnet da — obschon, ich hätte es nicht ausgehalten, ich hätte dabeigestanden. Wie geht es Ihnen, Lillian?«
Sie wußte, was er meinte. »Gut«, sagte sie. »Wie ist alles oben?«
»So wie immer. In den paar Monaten hat sich wenig geändert.«
In den paar Monaten, dachte sie. Waren es nicht Jahre?
»Und wie geht es — « sie zögerte, aber sie wußte plötzlich, daß sie nur deswegen angerufen hatte, »— wie geht es Boris?«
»Wem?«
»Boris.«
»Boris Wolkow? Man sieht ihn wenig. Er kommt nicht mehr ins Sanatorium. Ich glaube, es geht ihm gut.«
»Haben Sie ihn irgendwann gesehen?«
»Ja, natürlich. Es ist allerdings schon zwei, drei Wochen her. Er ging mit seinem Hund spazieren, dem Schäferhund, den Sie ja kennen. Wir haben nicht miteinander gesprochen. Wie ist es da unten? So, wie Sie es sich gedacht haben?«
»Ungefähr so«, sagte Lillian. »Es kommt wohl immer darauf an, was man daraus macht. Liegt noch Schnee oben?«
Hollmann lachte. »Der ist weg. Die Wiesen sind am Blühen. Lillian — «, er machte eine Pause, »— ich werde in ein paar Wochen hier herauskommen. Es ist kein Schwindel. Der Dalai Lama hat es mir gesagt.«
Читать дальше