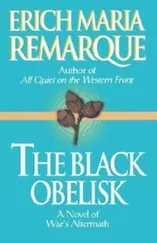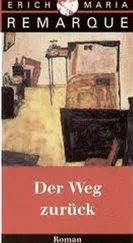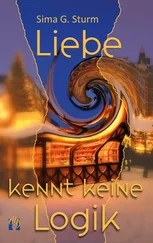Lillian bekam neue Angebote — eines, unanständige Photographien zu kaufen, zwei, beschützt zu werden, drei zu einem Ausflug im Auto. Außerdem wurden ihr billige Juwelen offeriert, junge Neger, junge Terrier und einige lesbische Damen. Sie verlor ihre Gelassenheit nicht, sondern gab dem Kellner ein Trinkgeld im voraus. Er sah es an und sorgte dafür, daß der stärkste Betrieb aufhörte. Sie bekam so Gelegenheit, ihren Pernod zu trinken und sich umzusehen.
Ein bleicher, bärtiger Mann an einem Nachbartisch begann sie zu zeichnen; ein Teppichverkäufer versuchte, ihr einen grasgrünen Gebetsteppich zu verkaufen, wurde aber vom Kellner verjagt; als letzter näherte sich nach einer Weile ein junger Mann, der sich als mitteloser Poet vorstellte. Lillian sah, daß sie wenig Ruhe haben würde, wenn sie allein bliebe. Sie lud deshalb den Poeten zu einem Glas Wein ein. Er bat, die Einladung in ein belegtes Brot zu ändern. Sie bestellte ihm ein Roastbeef.
Der Poet hieß Gérard. Er las ihr nach dem Essen zwei Gedichte vor; zwei andere rezitierte er aus dem Kopf. Es waren Elegien über Tod, Sterben, Vergänglichkeit und die Sinnlosigkeit des Lebens. Lillian wurde heiter. Der Poet war dünn, aber ein fabelhafter Esser. Sie fragte ihn, ob er noch ein Roastbeef vertilgen könne. Gérard erklärte, er könne mit Leichtigkeit und sie verstände etwas von der Dichtkunst; ob sie nicht auch finde, daß das Dasein trostlos sei? Wozu lebe man? Er aß zwei weitere Roastbeefs, und seine Verse wurden noch schwermütiger. Er begann das Problem des Selbstmordes zu diskutieren. Er selbst wäre dazu bereit — morgen natürlich, nicht heute, nach einem so reichlichen Essen. Lillian wurde noch heiterer; Gérard war zwar mager, aber er sah gesund genug aus, um noch fünfzig Jahre zu leben.
* * *
Clerfayt hockte eine Zeitlang in der Ritz-Bar herum. Dann beschloß er Lillian anzurufen. Der Nachtportier meldete sich. »Madame ist nicht im Hotel«, erklärte er, als er Clerfayt erkannte.
»Wo ist sie?«
»Sie ist fortgegangen. Vor einer halben Stunde.«
Clerfayt kalkulierte; sie konnte in so kurzer Zeit nicht gepackt haben. »Hat sie Koffer mitgenommen?« fragte er zur Vorsicht.
»Nein, mein Herr. Sie hat einen Regenmantel angehabt.«
»Gut, danke.«
Einen Regenmantel, dachte Clerfayt. Sie bringt es fertig, ohne Gepäck zum Bahnhof zu gehen und abzufahren — zurück zu ihrem Boris Wolkow, der so viel besser ist als ich.
Er lief zum Wagen. Ich hätte bei ihr bleiben sollen, dachte er. Was ist nur mit mir los? Wie ungeschickt man wird, wenn man wirklich liebt! Wie der Schellack der Überlegenheit von einem abfällt! Wie allein man ist, und wie alle glatte Erfahrung verdampft zu Nebel, der einem nur den Blick unsicher macht! Ich darf sie nicht verlieren!
Er ließ sich vom Nachtportier noch einmal beschreiben, in welcher Richtung sie gegangen sei. »Nicht zur Seine, mein Herr«, sagte der Bursche beruhigend. »Nach rechts. Vielleicht wollte sie noch etwas spazieren gehen und kommt bald zurück.«
Clerfayt fuhr langsam den Boulevard St.-Michel entlang. Lillian hörte Giuseppe und sah ihn gleich darauf.
»Und der Tod?« fragte sie Gérard, der eine Käseplatte vor sich hatte. »Wenn nun der Tod noch trostloser ist als das Leben?«
»Wer sagt uns«, fragte Gérard, schwermütig kauend zurück, »ob das Leben nicht eine Strafe ist, die wir erdulden müssen für ein Verbrechen, das wir in einer anderen Welt begangen haben? Vielleicht ist dies hier die Hölle und nicht das, was die Kirche uns nach dem Tode prophezeit.«
»Sie prophezeit auch den Himmel.«
»Vielleicht sind wir dann alle gefallene Engel, die zu einer Anzahl von Jahren Bagno auf der Erde verurteilt worden sind.«
»Wir können die Straße abkürzen, wenn wir wollen.«
»Der Freitod!« Gérard nickte begeistert. »Und wir scheuen davor zurück. Dabei ist er die Befreiung! Wäre das Leben Feuer, wir wüssten, was wir täten! Rausspringen! Die Ironie —«
Giuseppe kam zum zweiten Mal vorbei; diesmal von der Place Edmond-Rostand her. Die Ironie, dachte Lillian, ist alles, was wir haben, und manchmal ist sie nicht ohne Reiz, so wie jetzt bei diesem Vortrag. Sie sah Clerfayt, der so intensiv die Menge auf der Straße mit den Augen durchsuchte, daß er sie zehn Schritt dahinter nicht bemerkte.
»Was wäre das Höchste, was sie vom Leben verlangen würden, wenn Ihre Wünsche erfüllt werden könnten?« fragte sie Gérard.
»Das ewige Unerfüllbare«, erwiderte der Poet sofort.
Sie sah ihn dankbar an. »Dann brauchen Sie also nichts mehr zu wünschen«, sagte sie. »Sie haben es bereits.«
»Nur noch einen Zuhörer wie Sie!« erklärte Gérard düster-galant und scheuchte den Zeichner fort, der das Porträt Lillians aus der Ferne beendet hatte und jetzt wieder an den Tisch kam. »Für immer. Sie verstehen mich.«
»Geben Sie das Bild mir«, sagte Clerfayt zu dem enttäuschten Zeichner.
Er war von hinten zu Fuß herangekommen und betrachtete Gérard missbilligend. »Scheren Sie sich weg«, sagte Gérard zu ihm. »Sehen Sie nicht, daß wir beschäftigt sind? Wir werden, weiß Gott, genug gestört. Garзon, noch zwei Pernod! Und werfen Sie diesen Herrn hinaus!«
»Drei«, erwiderte Clerfayt und setzte sich. Der Zeichner stand in beredter Stummheit neben ihm. Er bezahlte ihn. »Es ist schön hier«, sagte er zu Lillian. »Warum sind wir nicht schon öfter hierher gekommen?«
»Und wer sind Sie, ungebetener Fremder?« fragte Gérard, immer noch einigermaßen sicher, daß Clerfayt eine Art Zuhälter sei und einen der üblichen Tricks versuchte, mit Lillian bekannt zu werden.
»Der Direktor der Irrenanstalt von St.-Germain-des-Prés, mein Sohn, und diese Dame ist eine unserer Patientinnen. Sie hat heute Ausgang. Ist etwas passiert? Bin ich schon zu spät gekommen? Kellner, nehmen Sie das Messer hier weg! Die Gabel auch!«
Das Interesse des Poeten siegte über den Skeptizismus in Gérard. »Wirklich?« flüsterte er. »Ich wollte immer schon —«
»Sie können ruhig laut sprechen«, unterbrach Clerfayt ihn. »Sie liebt ihre Situation. Völlige Verantwortungsfreiheit. Sie untersteht keinem Gesetz. Selbst wenn sie mordete, würde sie freigesprochen.«
Lillian lachte. »Es ist umgekehrt«, sagte sie zu Gérard.
»Er ist mein früherer Mann. Entlaufen aus der Anstalt. Typisch ist, daß er mich beschuldigt.«
Der Poet war kein Narr. Außerdem war er Franzose. Er sah jetzt klar und erhob sich mit einem zauberhaften Lächeln. »Manche gehen zu spät, und manche gehen zu früh«, erklärte er. »Geh zur rechten Zeit — also sprach Zarathustra. Morgen, Madame, wird ein Gedicht für Sie hier beim Kellner liegen.«
* * *
»Es ist schön, daß du gekommen bist«, sagte Lillian.
»Wenn ich nun geschlafen hätte, hätte ich dies alles versäumt. Das grüne Licht und die süße Rebellion des Blutes. Und den Schlamm und die Schwalben darüber.«
Clerfayt nickte. »Verzeih mir. Aber du bist manchmal etwas zu schnell für mich. Du tust in Stunden, wozu andere Jahre brauchen — so wie die Zauberpflanzen, die unter den Händen eines Yogis in Minuten aufwachsen und blühen —«
— und sterben, dachte Lillian. »Ich muß es tun, Clerfayt«, sagte sie. »Ich habe so viel nachzuholen. Deshalb bin ich auch so oberflächlich. Für die Weisheit ist später noch genug Zeit.«
Er nahm ihre Hand und küßte sie. »Ich bin ein Idiot. Und ich werde es täglich mehr. Aber ich habe nichts dagegen. Es gefällt mir. Wenn du nur da bist. Ich liebe dich sehr.«
Ein scharfer, schneller Streit entstand plötzlich vor dem Café. In Sekunden war ein Polizist da, ein paar Algerier gestikulierten, ein Mädchen schimpfte, Zeitungsjungen rannten und schrien.
»Komm«, sagte Lillian. »In meinem Zimmer ist noch Wein.«
Читать дальше