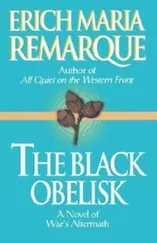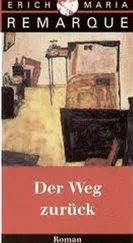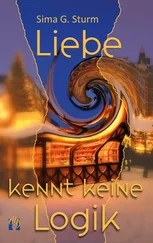* * *
Der erste, den sie wieder aufsuchte, war Onkel Gaston. Er war überrascht, sie zu sehen, zeigte aber nach einigen Minuten so etwas wie vorsichtige Freude. »Wo wohnst du jetzt?« fragte er.
»Im Bisson. Nicht teuer, Onkel Gaston.«
»Du glaubst, Geld vermehre sich über Nacht. Wenn du so weitermachst, hast du bald nichts mehr. Weißt du, wie lange es noch reichen wird, wenn du es so weiter ausgibst?«
»Nein. Ich will es auch nicht wissen.«
Ich muß mich beeilen zu sterben, dachte sie ironisch.
»Du hast immer über deine Verhältnisse gelebt. Früher lebte man von den Zinsen seines Kapitals.«
Lillian lachte. »Ich habe gehört, daß in der Stadt Basel an der Schweizer Grenze jemand bereits als Verschwender angesehen wird, wenn er nicht von den Zinseszinsen lebt.«
»Die Schweiz«, erwiderte Gaston, als spräche er von der Venus Kallipygos. »Mit der Währung! Ein glückliches Volk!« Er sah Lillian an. »Ich könnte dir ein Zimmer in meiner Wohnung freimachen. Du spartest so das Hotel.«
Lillian blickte sich um. Er würde seine kleinen Ränke spinnen und versuchen, sie unter die Haube zu bringen, dachte sie. Und sie zu überwachen. Er hatte Angst, daß sie ihn sein eigenes Geld kosten könne. Ihr kam keinen Augenblick der Gedanke, ihm die Wahrheit zu sagen. »Ich werde dich nichts kosten, Onkel Gaston«, erklärte sie. »Nie!«
»Der junge Boileau hat öfter nach dir gefragt?«
»Wer ist das?«
»Der Sohn von den Uhren-Boileaus. Sehr anständige Familie. Die Mutter —«
»Der mit der Hasenscharte?«
»Hasenscharte! Was du für vulgäre Namen hast! Eine kleine Sache, die in alten Familien öfter vorkommt! Außerdem ist sie operiert. Kaum zu sehen. Männer sind doch schließlich keine Mannequins!«
Lillian betrachtete den kleinen, rechthaberischen Mann. »Wie alt bist du, Onkel Gaston?«
»Was soll das schon wieder? Du weißt es ja!«
»Und wie alt, glaubt du, wirst du werden?«
»Das ist eine geradezu unanständige Frage. So etwas fragt man ältere Leute nicht. Das steht bei Gott.«
»Bei Gott steht vieles. Er wird einmal eine Menge Fragen zu beantworten haben, meinst du nicht? Ich habe ihn auch einiges zu fragen.«
»Was?« Gaston riß die Augen auf. »Was redest du da?«
»Nichts.« Lillian mußte einen kurzen Zorn unterdrücken. Da stand dieser ruppige Zwerghahn vor ihr, unverwüstlich, ein Champion über eine Rennstrecke von dreißig Zentimetern, er war alt, aber er würde bestimmt noch einige Jahre länger leben als sie, er wußte alles, hatte über alles ein Urteil und war mit seinem Gott auf du und du.
»Onkel Gaston«, sagte sie, »wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, würdest du es anders leben?«
»Selbstverständlich!«
»Wie?« fragte Lillian mit schwacher Hoffnung.
»Ich würde selbstverständlich nicht in die Abwertung des Francs geraten sein. Schon 1914 hätte ich amerikanische Aktien gekauft — dann spätestens 1938 —«
»Gut, Onkel Gaston«, unterbrach Lillian. »Ich verstehe.« Ihr Zorn war verflogen.
»Du verstehst gar nichts. Sonst würdest du nicht mit dem bißchen Geld, das du noch hast, so wirtschaften! Natürlich, dein Vater —«
»Ich weiß, Onkel Gaston. Ein Verschwender! Aber es gibt noch einen viel größeren als ihn.«
»Wen?«
»Das Leben. Es verschwendet dich und mich und alle anderen.«
»Papperlapapp! Das ist Salon-Bolschewismus! Gewöhne dir das ab. Das Leben ist zu ernst dafür.«
»Das ist es. Man muß seine Rechnungen bezahlen. Gib mir Geld. Und tu nicht so, als sei es dein eigenes. Es ist meines.«
»Geld! Geld! Das ist alles, was du vom Leben kennst!«
»Nein, Onkel Gaston. Das ist alles, was du kennst!«
»Sei froh! Sonst hättest du längst nichts mehr.«
Gaston schrieb widerwillig einen Scheck aus. »Und später?« fragte er bitter, während er das Papier in der Luft schwenkte, um die Tinte zu trocknen. »Was wird später?«
Lillian sah ihm fasziniert zu. Ich glaube, er will sogar das Löschpapier sparen, dachte sie. »Es gibt kein Später«, sagte sie.
»Das behaupten alle. Und dann kommen sie, wenn sie nichts mehr haben, und man muß seine eigenen kleinen Ersparnisse —«
Der Zorn war plötzlich wieder da, klar und heftig. Lillian riß ihrem Onkel den Scheck aus der Hand.
»Lass das Jammern! Und geh und kauf dir amerikanische Aktien, du Patriot!«
* * *
Sie ging die nassen Straßen entlang. Es hatte geregnet, während sie bei Gaston gewesen war, aber jetzt schien die Sonne wieder und spiegelte sich auf dem Asphalt und in den Pfützen am Rande der Straße. Sogar in den Pfützen spiegelt sich der Himmel, dachte sie und mußte lachen. Vielleicht spiegelte Gott sich dann auch sogar in Onkel Gaston. Aber wo in ihm? Er war schwerer zu finden in Gaston als das Blau und das Glitzern des Himmels in dem schmutzigen Wasser, das zu den Kanallöchern abfloss. Er war schwerer zu finden in den meisten Menschen, die sie kannte. Sie hockten in ihren Büros hinter ihren Schreibtischen, als wären sie doppelte Methusalems, das war ihr trostloses Geheimnis! Sie lebten, als gäbe es keinen Tod. Aber sie taten es wie Krämer, nicht wie Helden. Sie hatten das tragische Wissen um das Ende verdrängt und spielten Vogel Strauß und kleinbürgerliche Illusion vom Ewigen Leben. Mit wackelnden Köpfen versuchten sie sich am Grabe gegenseitig noch zu betrügen und das aufzuhäufen, was sie am frühesten zu Sklaven ihrer selbst gemacht hatte: Geld und Macht.
Sie nahm einen Hundertfrancs-Schein, betrachtete ihn und warf ihn mit einem Entschluß in die Seine. Es war eine sehr kindisch-symbolische Handlung des Protestes, aber das war ihr gleich. Es tat ihr gut, es zu tun. Den Scheck Onkel Gastons warf sie ohnehin nicht weg. Sie ging weiter und kam zum Boulevard St.-Michel. Der Verkehr toste um sie herum. Menschen rannten, drängten sich, hatten es eilig, die Sonne blitzte auf Hunderten von Automobildächern, Motoren tobten, überall gab es Ziele, die so rasch wie möglich erreicht werden mußten, und jedes dieser kleinen Ziele verdeckte das letzte so sehr, daß es schien, als wäre es gar nicht da.
Sie überquerte die Straße zwischen zwei zitternden, von einem roten Verkehrszeichen gebannten Reihen von heißen Monstern, so wie Moses mit dem Volk Israel einst das Rote Meer. Im Sanatorium war es anders gewesen, dachte sie, da stand das letzte Ziel wie eine finstere Sonne immer am Himmel, man lebte unter ihm, man ignorierte es, aber man verdrängte es nicht, und das gab tiefere Einsicht und tieferen Mut. Wer wußte, daß er geschlachtet wurde und nicht entkommen konnte, und wer dem entgegensah mit dieser letzten Einsicht und diesem letzten Mut, der war nicht ganz ein Opfertier mehr. Er hatte den Schlächter um ein winziges überwunden.
Sie kam zum Hotel. Sie hatte wieder ein Zimmer im ersten Stock, um nur eine Treppe steigen zu müssen. Der Mann mit den Seetieren stand vor der Tür des Restaurants. »Es gibt wunderbare Garnelen«, sagte er. »Austern sind fast vorbei. Die sind erst im September wieder gut. Werden Sie dann noch hier sein?«
»Sicher«, erwiderte sie.
»Soll ich Ihnen ein Bukett Garnelen zurechtmachen? Die grauen sind am besten. Die rosafarbenen sehen besser aus. Die grauen?«
»Die grauen. Ich lasse den Korb gleich herunter. Dazu eine halbe Flasche Vin rosé, sehr kalt. Sagen Sie es Lucien, dem Oberkellner.«
Sie stieg die Treppe langsam hinauf. Dann ließ sie ihren Korb hinunter und zog ihn wieder herauf. Der Wein war entkorkt und so kalt, daß die Flasche beschlagen war. Sie setzte sich in die Fensterbank, die Füße heraufgezogen und gegen den Rahmen gestemmt, den Wein neben sich. Lucien hatte auch ein Glas und eine Serviette eingepackt. Sie trank und begann die Garnelen zu schälen. Das Leben war gut so, fand sie, und wollte nicht weiter nachdenken. Dunkel fühlte sie etwas von einem großen Ausgleich, aber sie wollte jetzt nichts davon wissen. Nicht in diesem Augenblick. Daß ihre Mutter an Krebs gestorben war, nach sehr schweren Operationen, hatte etwas damit zu tun. Es gab immer noch Schlimmeres als das, was man selbst hatte. Sie blinzelte in die Sonne. Sie fühlte das Licht. So sah Clerfayt sie, als er gegen alle Erwartungen noch einmal am Bisson vorbeipatrouillierte.
Читать дальше