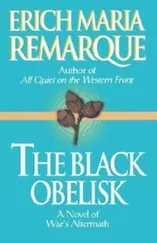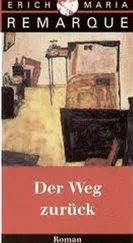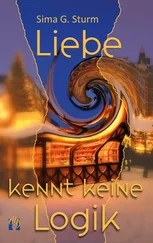Es verstärkte sich, als sie über die Piazza ging. Etwas vom Abenteuer jeden Anfangs war darin. Sie hatte kein Ziel; sie ließ sich treiben und landete im unteren Restaurant von Quadri, weil sie es charmant fand, daß ein kleiner Ess-Salon mit Wandmalereien nach Szenen aus dem achtzehnten Jahrhundert und goldenen Appliken sich einfach nach der Straße zu öffnete. Sie aß Scampis und trank einen leichten weißen Wein. Neben ihr an den Wänden tanzten Masken. Sie fühlte sich ähnlich, entkommen, versteckt in einer unsichtbaren Maske, in demselben sanften Rausch verantwortungsloser Freiheit, den jede Maske gab. Tausend Anfänge lagen vor ihr in der rosa Dämmerung, so wie die tausend Gassen dieser Stadt, die die Masken liebte. Wohin führten sie? Zu unbekannten, ungenannten neuen Entdeckungen oder nur zu reizvollen, ermüdenden Wiederholungen, aus denen man mit dem Katzenjammer hervorkam, das Kostbarste daran verschwendet zu haben, was es gab: Zeit? Man muß sie verschwenden, dachte Lillian, gedankenlos, trotz allem, oder man ist wie der Mann im Märchen, der so viel wollte für sein Goldstück, daß er sich nicht entscheiden konnte, was, und darüber starb.
»Wohin kann ich heute abend gehen?« fragte sie den Kellner.
»Heute abend? Vielleicht ins Theater, Signora.«
»Gibt es da noch Plätze?«
»Wahrscheinlich. Im Theater gibt es immer noch Plätze.«
»Wie kommt man zum Theater?«
Der Kellner begann ihr den Weg zu beschreiben.
»Kann man keine Gondel nehmen?« fragte sie.
»Auch das. Früher hat man es immer getan. Jetzt nicht mehr. Das Theater hat zwei Eingänge. Es ist nicht weit zu gehen.«
Lillian nahm eine Gondel beim Palazzo Ducale. Der Kellner hatte recht gehabt, außer ihr kam nur noch eine zweite Gondel an. Ein älteres amerikanisches Liebespaar saß darin und photographierte mit Blitzlicht. Es photographierte auch Lillians Gondel. »Eine Frau sollte in Venedig nicht allein sein«, sagte der Gondoliere, während er ihr beim Aussteigen half.
»Eine junge Frau noch weniger. Eine schöne nie.«
Lillian sah ihn an. Er war alt und wirkte nicht, als wolle er sich selbst als Medizin anpreisen. »Kann man hier je allein sein?« sagte sie und sah in den roten Abend über den Dächern.
»Hier mehr als irgendwo anders, Signora. Wenn man nicht hier geboren ist, natürlich.«
* * *
Lillian kam gerade zurecht, als der Vorhang aufging. Ein Lustspiel aus dem achtzehnten Jahrhundert wurde gespielt. Sie sah sich im Theater um, das vom Licht der Bühne und der Soffitten gedämpft erleuchtet war. Es war das schönste Theater der Welt, und es mußte vor der Einführung des elektrischen Lichtes, mit seinen vielen Kerzen und den bemalten Rängen zauberhaft gewesen sein. Es war es noch immer.
Sie blickte auf die Bühne. Sie verstand nicht viel Italienisch und gab es bald auf, zuzuhören. Das merkwürdige Gefühl von Einsamkeit und Schwermut, das sie schon in Rom gehabt hatte, ergriff sie wieder. Hatte der Gondoliere recht? Oder kam es daher, daß sie es auf eine so nachdrückliche Weise symbolisch fand, daß man irgendwo ankam, einem Spiel lauschte, von dem man nichts verstand, und es verlassen mußte, wenn man gerade begann, etwas zu ahnen? Es war nichts Ernstes, was auf der Bühne vor sich ging, das konnte man sehen — eine Komödie, Verführung, Täuschung, etwas grausamer Spaß über einen Dummkopf, und Lillian wußte nicht, was sich in ihr deswegen so rührte, daß es zu einem eigentümlichen Schluchzen wurde und sie das Taschentuch an die Lippen nehmen mußte. Erst als es noch einmal wiederkam und sie die dunklen Flecken in ihrem Taschentuch sah, wußte sie es.
Sie blieb einen Augenblick sitzen und versuchte, es zu unterdrücken; aber das Blut kam wieder. Sie mußte hinausgehen, aber sie wußte nicht, ob sie es allein konnte. Sie bat den Mann neben sich auf französisch, sie hinauszuführen. Er schüttelte unwillig den Kopf, ohne sie anzusehen. Er folgte dem Stück und verstand nicht, was sie wollte. Sie wandte sich an die Frau zu ihrer Linken. Verzweifelt suchte sie nach dem italienischen Wort für Hilfe. Es fiel ihr nicht ein. »Misericordia«, murmelte sie schließlich. »Misericordia, per favore!«
Die Frau blickte erstaunt auf. »Are you sick?«
Lillian nickte, das Taschentuch an den Lippen, und machte eine Bewegung, daß sie hinauswollte.
»Too many cocktails«, sagte die blonde ältere Frau.
»Mario, darling, help the lady to get some fresh air. What a mess!«
Mario erhob sich. Er stützte Lillian. »Just to the door«, flüsterte sie.
Er nahm ihren Arm und brachte sie hinaus. Köpfe wandten sich flüchtig. Auf der Bühne feierte der pfiffige Liebhaber gerade einen Triumph. Mario öffnete die Tür zum Foyer und starrte Lillian an. Vor ihm stand plötzlich eine sehr blasse Frau in einem weißen Kleid, der das Blut zwischen den Fingern auf die Brust tropfte. »But, Signora, you are really sick«, sagte er fassungslos. »Shall I take you to a hospital?«
Lillian schüttelte den Kopf. »Hotel Danieli. Einen Wagen — bitte — « würgte sie, »Taxi —«
»Aber Signora, in Venedig gibt es kein Taxi! Nur eine Gondel! Oder ein Motorboot. Sie müssen in eine Klinik.«
»Nein, nein! Ein Boot. Zum Hotel. Dort ist sicher ein Arzt. Bitte — nur bis zu einem Boot — Sie müssen doch zurück —«
»Ach«, sagte Mario, »Mary kann warten. Sie versteht ohnehin kein Wort Italienisch. Und das Stück ist langweilig.«
Das blasse pompejanische Rot des Foyers nach dem starken Rot der Vorhänge. Das Weiß der Dekorationen. Türen. Stufen und Wind; dann ein Platz mit dem Geräusch von Tellern, Gabeln, ein Restaurant auf der Straße mit Gelächter und dem Aufruhr des Essens. Daran vorbei, zu einem finsteren, schlecht riechenden, schmalen Kanal, aus dem ein Boot auftauchte und ein Fährmann, wie ein Ferge des Styx: »Gondola, Signora, Gondola?«
»Ja! Rasch! Rasch! Die Signora ist krank.«
Der Gondoliere starrte. »Erschossen?«
»Frag nicht! Fahr zu! Rasch!«
Der schmale Kanal. Eine kleine Brücke. Häusermauern. Das Klatschen des Wassers. Der lang gezogene Ruf des Gondolieres an den Kreuzungen. Vermoderte Stufen; verrottete Türen; winzige Gärten mit Geranien; Zimmer mit Radios und nackten gelben Glühbirnen; Wäsche, zum Trocknen aufgehängt; eine Ratte wie ein Seiltänzer an einem Hause entlang balancierend; die scharfen Stimmen von Frauen, Geruch nach Zwiebeln und Knoblauch und Öl und der schwere, tote Geruch des Wassers.
»Wir sind gleich da«, sagte Mario.
Ein zweiter Kanal, breiter. Dann die stärkeren Wellen, die Weite des Canale Grande. »Sollen wir ein Motorboot anhalten?«
Sie lag auf den hinteren Sitzen, schräg, wie sie hineingefallen war. »Nein«, flüsterte sie. »Weiter! Nicht wechseln —«
Die Hotels, erleuchtet, die Terrassen, Vaporetti, fauchend, qualmend, voll von Passagieren, Motorboote mit weißen Uniformen — wie einsam man war, mitten im süßen Tumult des Daseins, wenn man um es kämpfte, und wie alles sich in einen Spuk verwandelte, in dem man nach Atem rang! Die Reihen der Gondeln, die vor den Anlegestellen wie schwarze Särge auf dem spiegelnden Wasser schwankten, wie schwarze, große Wassergeier, die mit metallenen Schnäbeln nach ihr zu hacken versuchten, vorbei, und dann die Piazetta, Lichtrauch, Weite und Sterne, ein heller Raum mit dem Himmel als Decke, und unter der Seufzerbrücke ein unerträglich süßer Tenor, der Santa Lucia sang in einem Boot mit Touristen. Wenn das jetzt Sterben wäre, dachte Lillian, so dazuliegen, den Kopf rückwärts, das Rauschen des Wassers dicht neben sich, den Fetzen Gesang vor sich und einen unbekannten Menschen neben sich, der immer wieder fragte: »How are you feeling? Könnten Sie noch zwei Minuten durchhalten? Wir sind gleich da.« Nein, es war nicht Sterben, wußte sie.
Читать дальше