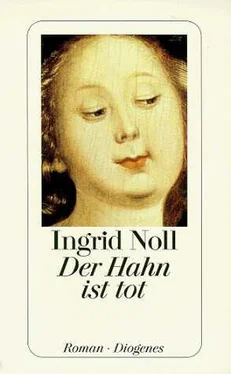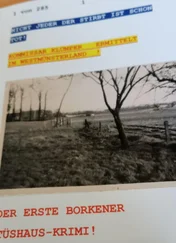Die vielen ungeeigneten Klamotten warf ich in den Schrank, schloß ab, eilte ans Fenster und spähte nach seinem Auto.
Dazwischen hetzte ich in die Küche: Alles vorbereitet, aber bevor er da war, konnte ich ja nicht gut den Fisch braten.
Witold kam pünktlich aufs akademische Viertel, in der Hand einen unpersönlichen Nelkenstrauß mit Asparagus, wo er doch in seinem Garten wirklich etwas Originelleres hätte pflücken können.
»Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Kommt Ihre reizende Freundin auch? Ein paar Näglein zum Besteck…«, und er überreichte mir etwas steif seine fünf gelben Nelken und behielt das zerknüllte Papier in der Hand. Zu diesem Strauß hätte meinerseits ein »aber das wäre doch nicht nötig gewesen« gepaßt. Ich unterließ es, bedankte mich und bemerkte maliziös, daß Beate einen Freund hätte, der sie unter der Woche völlig in Beschlag lege. Witold lächelte dazu: Entweder wußte er das bereits, oder es war ihm egal, oder er konnte sich vorzüglich beherrschen.
Ich goß Sherry ein, sauste in die Küche, setzte Nudelwasser auf. Eigentlich war ich nicht overdressed, fand ich.
Witold war sehr neutral angezogen, ohne Schlips, aber mit einem sommerlich hellen Jackett zu Edeljeans. Wir waren ein wenig befangen.
»Liegt die Waffe im Vater Rhein?« wollte er plötzlich wissen.
Nein, das tat sie nicht, aber ich antwortete: »Ja, natürlich, schon seit Wochen!«
Er sollte sich bloß nicht über mich aufregen, ich hatte den Revolver zwar nicht vergessen, aber den Auftrag noch nicht ausgeführt, weiß der Himmel, warum.
Das Essen war mir sogar gelungen. Witold lobte es mit beleidigender Höflichkeit, aß allerdings wenig und trank auch nicht viel. Die zauberische Stimmung damals bei Handkäs und Apfelwein kam nicht wieder auf, es war alles ein wenig künstlich.
Ich versuchte, Charme zu produzieren, berührte ihn beim Sprechen einmal am Arm, so wie ich das bei anderen Frauen beobachtet hatte, war aber sehr verkrampft. Nach dem Essen saßen wir auf meinen zugegebenermaßen ungemütlichen Sesseln, und ich wollte Sekt aufmachen. Witold wehrte ab. Er habe zum Essen ja schon Wein getrunken und vorher den Sherry, schließlich müsse er noch heimfahren. Außerdem sei morgen erst Freitag und für ihn fast der härteste Tag.
»Seien Sie mir nicht böse, wenn ich aus diesem Grund nicht allzu lange bleiben kann.«
»Auf der Kirmes haben wir ›du‹ zueinander gesagt«, entfuhr es mir, zu meinem Leidwesen in einem gekränkten Unterton.
»Richtig!« rief Witold mit unaufrichtiger Fröhlichkeit, »gut, daß du mich daran erinnerst! Also, trinken wir ein zweites Mal Bruderschaft!«
Er hob sein Glas mit dem Rest Weißwein, das er vom Eßtisch mitgenommen hatte, und sagte: »Thyra!«
Todesmutig hielt ich ihm das Gesicht entgegen. Ich spürte eine flüchtige Berührung auf der Wange, das war’s dann auch.
Witold plauderte noch eine Viertelstunde, erzählte von seinen Söhnen und der Schule; um halb elf war er weg, nicht ohne das »exquisite und deliziöse Mahl« abermals gelobt zu haben, ohne neue Verabredung, ohne mir die Möglichkeit gegeben zu haben, ihm etwas näherzukommen. Von Verführung ganz zu schweigen.
Trotz seiner fünfundfünfzig Jahre war der Chef immer noch ein häßlicher Mann. Er lagerte mit halbem Gesäß auf meinem Schreibtisch, was ich nicht ausstehen konnte, auch der Dieskau ließ seinen milden Bariton warnend vernehmen. Der Chef lachte aber darüber.
»Frau Hirte, in letzter Zeit werden Sie immer jünger, das ist wirklich ein Phänomen!«
Ich wartete, welche Sonderaufträge er für mich hatte.
»Wann kommt Frau Römer eigentlich aus der Kur zurück?« wollte er wissen.
»Übermorgen. Ich hole sie von der Bahn ab und bringe sie heim; natürlich will sie ihren Dieskau gleich zurückhaben.«
»Ich glaube«, überlegte der Chef, »daß Frau Römer gar nicht wieder arbeiten wird, sondern sich berenten läßt. Nach dieser schweren Operation bekommt sie bestimmt eine Rente auf zwei Jahre, und dann hat sie die Altersgrenze sowieso erreicht.
Ich denke, sie wird nicht mehr zurückkommen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie dieses Zimmer übernehmen möchten?«
Ich freute mich, denn es war der intimste und abgelegenste Raum, man hatte darin völlig seine Ruhe und einen schönen Blick in eine Kastanie.
»Außerdem sollten Sie Urlaub machen, solange man noch irgendwo Sonne tanken kann«, fuhr er fort. Er meinte es gut, aber mir war nicht so recht nach Urlaub zumute.
Immerhin, der Chef machte sich Gedanken über mich.
Am gleichen Tag erreichte mich abends ein Anruf — es war mein früherer Berliner Freund Hartmut. Er war etwas verlegen und meinte, er sei auf der Durchreise, und wir hätten uns ja fast ein Vierteljahrhundert nicht gesehen, ob er mich zum Essen einladen dürfe. Ich war platt. Es kam sehr plötzlich, ich war eigentlich müde. Andererseits siegte dann die Neugierde, obgleich ich mir vorgenommen hatte, diesen Menschen nie wieder zu sehen. Hartmut entschuldigte sich höflich, daß er mich nicht abholen könne, er sei ohne Auto in Westdeutschland.
Eine Stunde später saß ich im Samtrock und der heraldischen Bluse in einem Nobelrestaurant und betrachtete meinen ehemaligen Freund. Ich hätte ihn nie wiedererkannt. Hartmut war zwar früher auch nicht besonders schön gewesen — er litt unter Akne —, aber er war schmal und groß und hatte ein sehr ebenmäßiges Gesicht. Groß war er zwar geblieben, doch die Gestalt war jetzt über jeden Verdacht der Unterernährung erhaben. Das ebenmäßige Gesicht war feist, rot, schwitzig und unangenehm. Mein Gott, wenn ich mit dem verheiratet wäre! dachte ich entsetzt. Eigentlich war es ein Glück, daß ich davon verschont geblieben war und jetzt die Chance hatte, einen Mann wie Witold zu lieben.
Hartmut war ganz begeistert von mir, schließlich hatte er mich nur als graue Maus gekannt. Nein, wie hübsch, elegant und jung ich wirke! Er kippte vorm Essen zwei Bier herunter, und das Schwitzen wurde stärker. Ich mußte aus meinem Leben erzählen, also bot ich ihm eine geschönte Kurzfassung an.
Als er dran war, kam das Essen. Unter heftigem Kauen, Mampfen und Schlingen berichtete er von großen beruflichen Erfolgen, viel Geld, einer Villa in Dahlem und einer großen Anwaltspraxis mit drei Partnern. Ich fragte nach der Familie.
Die beiden großen Kinder seien aus dem Haus. Relativ spät hatte seine Frau noch ein drittes, behindertes Kind bekommen.
Er sah mich trostheischend an, und ich versicherte, das tue mir leid. Hartmut schüttete jetzt ein Glas Wein nach. Schließlich sprudelte es heraus, wie unglücklich seine Ehe sei: Die Frau liebe nur dieses schwierige Kind und sonst niemanden. Sie wolle es partout nicht weggeben, und er käme total zu kurz.
Ich hätte zwar lieber gehört, daß seine Frau ihn laufend betrog, aber so war es mir auch recht.
»Ach Rosi«, seufzte er transpirierend und schnaufend, »ich habe später noch oft an dich gedacht. Es war nicht nett, wie ich mich damals verhalten habe, aber ich bin dafür gestraft worden. Vielleicht sollten wir wieder Freunde werden.«
Er widerte mich an. Ich wollte heim. Hartmut hielt meine Hand eisern fest, er war angetrunken. Schließlich bettelte er, ich solle doch bei ihm im Hotel bleiben.
Ich stand auf, entriß ihm die Hand und sagte, es wäre Zeit für mich.
Zu Hause überlegte ich, ob ich vielleicht auf Witold einen ähnlichen Eindruck gemacht haben könnte wie heute Hartmut auf mich, denn er war neulich ebenso schnell, höflich und kühl verschwunden wie jetzt ich.
Übrigens rief Hartmut am nächsten Abend von seinem Berliner Büro aus an und entschuldigte sich nach Fünfziger-Jahre-Kavaliersart, daß er sich »ein wenig vorbeibenommen« hätte; damit war für ihn alles in Butter.
»Also, bis zum nächsten Treffen«, schnarrte er in den Hörer.
Читать дальше