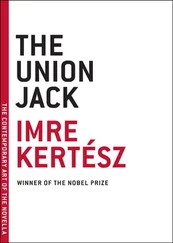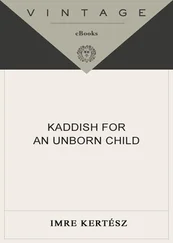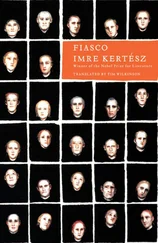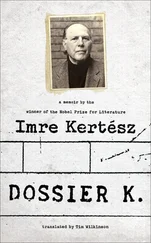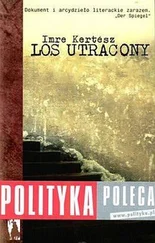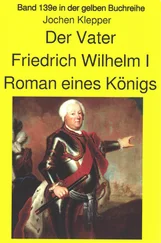Die Zeit verging im Krankenhaus leicht: Wenn ich nicht gerade schlief, beschäftigten mich Hunger, Durst, der Schmerz in der Wunde, da und dort eine Unterhaltung oder das Ereignis der Behandlung – aber auch ohne Beschäftigung, ja, ich darf sagen: gerade dank des angenehm kribbelnden Bewusstseins davon, dank dieses unversiegbare Freude bietenden Privilegs befand ich mich sehr wohl. Hie und da fragte ich auch die Neuankömmlinge aus: Was es Neues im Lager gebe, aus welchem Block sie kämen und ob sie nicht zufällig einen gewissen Bandi Citrom aus Block fünf kennten, einen Mittelgroßen mit gebrochener Nase und Zahnlücken vorn, aber keiner wusste etwas. Was ich im Behandlungszimmer an Wunden sah, war der meinen ähnlich, ebenfalls hauptsächlich am Ober- oder Unterschenkel, obwohl die Wunden manchmal auch weiter oben vorkamen, an der Hüfte, hintenherum, an den Armen, sogar am Hals und am Rücken; es waren von der Wissenschaft so genannte Phlegmone, so hörte ich es immer wieder, deren Entstehen und gehäuftes Auftreten unter den gewöhnlichen Umständen eines Konzentrationslagers keineswegs etwas Besonderes oder Erstaunliches war, wie ich von den Ärzten erfuhr. Etwas später kamen dann die, denen man ein, zwei, ja sogar manchmal alle Zehen abschneiden musste, und sie berichteten, draußen sei es Winter, und in den Holzschuhen seien ihnen die Füße erfroren. Ein andermal betrat, in maßgeschneidertem Sträflingsanzug, ein offensichtlich hochrangiger Würdenträger den Behandlungsraum. Ich hörte das leise, aber gut verständliche Wort «Bonjour!», und daraus sowie aus dem F in seinem roten Dreieck folgerte ich sogleich, dass er Franzose, und aus seiner mit «O.-Arzt» beschriebenen Armbinde, dass er offenbar der Oberarzt unseres Krankenhauses war. Ich schaute mir ihn gut an, denn ich hatte schon lange keinen so schönen Mann gesehen, der mit ihm vergleichbar gewesen wäre: Er war nicht sehr groß, sein Anzug aber in den richtigen Proportionen ausgefüllt mit Fleisch, das sich überall in ausreichender Menge über die Knochen spannte, sein Gesicht ebenso voll, jeder Zug unverwechselbar der seine, mit erkennbarem Ausdruck und Mienenspiel, sein Kinn rund, mit einer Vertiefung in der Mitte, seine etwas dunkle, olivfarbene Haut schimmerte im Licht, so wie einst Haut geschimmert hatte, früher einmal, zu Hause, unter den Menschen. Mir schien er noch nicht sehr alt, so um die dreißig herum. Wie ich sah, wurden auch die Ärzte sehr munter, sie bemühten sich, ihm gefällig zu sein, ihm alles zu erklären, das aber, wie ich merkte, nicht so sehr nach dem lagerüblichen Brauch, sondern eher nach alter, heimatlicher und irgendwie sogleich Erinnerungen heraufbeschwörender Gewohnheit und mit der Gewähltheit, Freude und dem gesellschaftlichen Eifer, die aufkommen, wenn man Gelegenheit hat, zu zeigen, dass man eine Kultursprache hervorragend verstehen und sprechen kann, wie etwa in diesem Fall Französisch. Andererseits – so musste ich sehen – bedeutete das dem Oberarzt offenbar nicht viel: Er schaute sich alles an, gab da und dort eine kurze Antwort, oder er nickte, das alles aber langsam, leise, schwermütig, gleichgültig, mit einem irgendwie unveränderlichen Ausdruck von Entmutigung, ja, beinahe schon Trauer im Gesicht und in den nussbraunen Augen. Ich war ganz verdutzt, weil ich überhaupt nicht begriff, woran das bei einer so wohlhabenden, gutgestellten, vornehmen Person liegen konnte, die es außerdem zu einem so hohen Rang gebracht hatte. Ich versuchte in seinem Gesicht zu lesen, seine Bewegungen zu verfolgen, und nur allmählich kam ich dahinter: Auch er war, da gab es nichts dran zu rütteln, letzten Endes gezwungen, hier zu sein, und nur allmählich und nicht ohne ein Staunen, eine heitere Verblüfftheit, verstärkte sich bei mir ein Eindruck, eine Vermutung, nämlich dass es eben dies war – mit einem Wort, dass ihn die Gefangenschaft an sich bedrückte, wie es schien. Ich hätte ihm schon beinahe gesagt, er solle nicht traurig sein, das sei ja noch das Geringste – aber ich fürchtete doch, es wäre vermessen, nun, und dann fiel mir auch noch ein, dass ich gar kein Französisch konnte.
Den Umzug habe ich im Großen und Ganzen verschlafen. Es war auch mir vorher zu Ohren gekommen: Anstelle der Zeitzer Zelte sei ein Winterlager erstellt worden, nämlich Steinbaracken, unter denen man nun auch eine als Krankenhaus geeignete nicht vergessen hatte. Wieder schmissen sie mich auf einen Lastwagen – aus der Dunkelheit konnte ich ersehen, dass es Abend, und aufgrund der Kälte, dass es mitten im Winter war –, und das Nächste, was ich erkannte, war dann schon der gutbeleuchtete, kalte Vorraum zu einem riesengroßen Saal und eine nach Chemikalien riechende Holzwanne: Darin musste auch ich – da nützten keine Klagen, keine Bitten und Proteste – zwecks Reinigung bis zum Scheitel untertauchen, was mich, abgesehen von der Kälte des Wanneninhalts, auch deshalb schaudern ließ, weil, wie ich sah, alle anderen Kranken vor mir auch schon – samt Wunden und allem – in diese braune Brühe getaucht waren. Und danach hat auch hier die Zeit angefangen zu vergehen, auch hier im Wesentlichen so, insgesamt mit nur wenigen Abweichungen, wie an dem Ort vorher. In unserem neuen Krankenhaus waren die Pritschen zum Beispiel dreistöckig. Auch zum Arzt wurde ich seltener gebracht, und so reinigte sich meine Wunde einfach so, an Ort und Stelle, auf ihre Art von selbst. Dazu machte sich bald auch an meiner Hüfte ein Schmerz, dann der schon bekannte brandrote Sack bemerkbar. Nach ein paar Tagen, als ich abgewartet hatte, ob es vergehen oder ob vielleicht sonst etwas dazwischenkommen würde, musste ich wohl oder übel dem Pfleger Mitteilung machen, und nach erneutem Drängen, nach weiteren Tagen des Wartens bin ich dann auch an die Reihe gekommen, bei den Ärzten im Vorraum der Baracke; so hatte ich nun nicht nur am Knie, sondern auch an der Hüfte einen Schnitt ungefähr von der Länge meiner Hand. Ein weiterer unangenehmer Umstand ergab sich aus meinem Platz auf einem der unteren Betten, gerade gegenüber einem hohen, schmalen, auf einen ewig grauen Himmel hinausgehenden, scheibenlosen kleinen Fenster, dessen Eisengitter wahrscheinlich wegen der hier drinnen dampfenden Ausdünstungen fortwährend von Eiszapfen und stacheligem Raureif überzogen war. Ich hingegen trug einzig, was eben einem Kranken zukam: ein kurzes Hemd ohne Knöpfe, na und dann im Hinblick auf den Winter eine seltsame grüne Strickmütze, die sich in Bögen über die Ohren und keilförmig über die Stirn legte und an einen Eisschnellläufer oder einen Darsteller des Satans auf der Bühne erinnerte, sonst aber sehr nützlich war. So fror ich dann viel, vor allem nachdem ich auch noch eine von meinen beiden Decken verloren hatte, mit deren Lumpen ich bis dahin die Mängel der anderen ganz ordentlich hatte ergänzen können: Ich solle sie ihm nur rasch leihen, er würde sie mir dann zurückbringen – so der Pfleger. Ich versuchte umsonst, sie mit beiden Händen festzuhalten, mich an ihr Ende zu klammern, er erwies sich als der Stärkere, und neben dem Verlust schmerzte mich auch der Gedanke einigermaßen, dass Decken – jedenfalls soviel ich wusste – hauptsächlich denen weggenommen wurden, bei denen man mit einem voraussichtlich baldigen Ende rechnete, ja, darauf wartete, wie ich wohl sagen dürfte. Ein andermal warnte mich eine inzwischen wohlbekannte, gleichfalls von einem der unteren Betten, aber irgendwo weiter hinten kommende Stimme: Es war anscheinend wieder ein Pfleger aufgetaucht, wieder mit einem neuen Kranken auf den Armen, und anscheinend eben dabei herauszufinden, zu wem, in welches unserer Betten er ihn legen könnte. Der mit der Stimme aber – so konnten wir erfahren – war aufgrund der Schwere seines Falls und ärztlicher Erlaubnis zu einem eigenen Bett berechtigt, und er schmetterte, donnerte mit so mächtiger Stimme: «Ich protestiere!» und berief sich darauf: «Ich habe das Recht! Fragen Sie den Arzt!», und erneut: «Ich protestiere!», dass die Pfleger ihre Last in der Tat jedes Mal zu einem anderen Bett weitertrugen – so zum Beispiel zu meinem, und auf diese Weise erhielt ich einen ungefähr gleichaltrigen Jungen als Schlafgenossen. Mir schien, als hätte ich sein gelbes Gesicht, seine großen, brennenden Augen schon irgendwo gesehen – ein gelbes Gesicht und große brennende Augen hatte allerdings jeder. Sein erstes Wort war, ob ich wohl einen Schluck Wasser hätte, und ich sagte, den würde ich auch nicht verschmähen; sein zweites, gleich nach dem ersten: und Zigaretten?, doch damit hatte er natürlich auch kein Glück. Er bot mir Brot dafür an, aber ich sagte ihm, Worte nützten da nichts, an ihnen liege es nicht, sondern ich hätte eben keine; daraufhin verstummte er für eine Weile. Ich vermute, dass er Fieber hatte, weil seinem ununterbrochen zitternden Körper eine ständige Hitze entströmte, die mir von angenehmem Nutzen war. Schon weniger freute mich, dass er sich nachts so viel herumwarf und -drehte, und das auch nicht immer mit der gebotenen Rücksicht auf meine Wunden. Ich sagte ihm dann auch, he, genug, er solle ein bisschen Ruhe geben, und irgendwann hat er meine Worte dann auch beherzigt. Erst am Morgen habe ich gesehen, warum: Zum Kaffee versuchte ich bereits vergeblich, ihn zu wecken. Ich habe dem Pfleger aber doch eiligst auch seinen Napf hingehalten, als dieser, gerade als ich ihm den Fall melden wollte, das unwirsch von mir verlangte. Dann habe ich auch seine Brotration in Empfang genommen sowie seine Suppe am Abend, und so auch im weiteren, bis er eines Tages anfing, sich ziemlich seltsam aufzuführen: Da blieb mir dann doch nichts anderes übrig, als es zu melden, ich konnte ihn nicht länger in meinem Bett aufbewahren, schließlich und endlich. Ich war ein bisschen beklommen, denn die Verspätung war schon recht gut festzustellen und der Grund, bei einiger Sachkenntnis, mit der ich ja rechnen durfte, ebenso leicht zu erraten – aber man hat ihn mit den anderen weggebracht und Gott sei Dank nichts gesagt und mich auch vorläufig ohne Genossen sein lassen.
Читать дальше