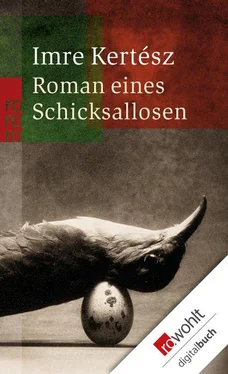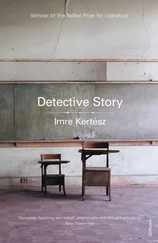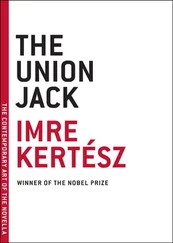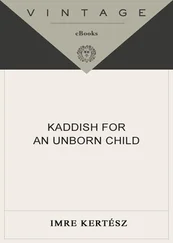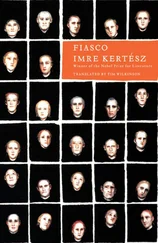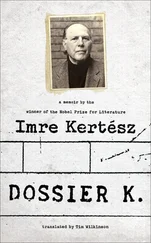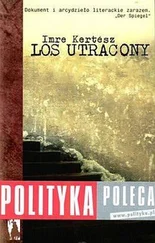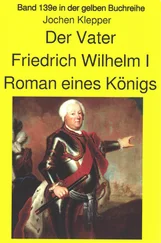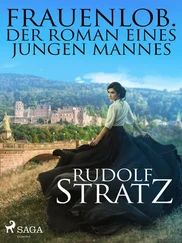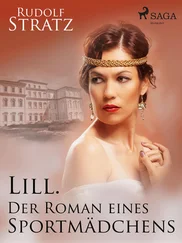Er selbst teilte uns die Suppe aus, mit einem komischen langstieligen Schöpflöffel, der mehr die Form eines Trichters hatte; zwei andere Männer, so eine Art Gehilfen, die ebenfalls nicht zu uns gehörten, händigten dazu rote Emaillenäpfe und zerbeulte Löffel aus – je einen für zwei Personen, da der Bestand knapp sei, wie sie uns mitteilten: weshalb das Geschirr – so fügten sie hinzu – sofort nach Gebrauch zurückzuerstatten sei. Nach einiger Zeit kam auch ich an die Reihe. Suppe, Napf und Löffel erhielt ich mit dem «Zierlederer» zusammen: Ich war nicht gerade erfreut, da es noch nie meine Gewohnheit gewesen war, mit anderen zusammen aus ein und demselben Teller und mit ein und demselben Löffel zu essen, doch auch das, ich sah es ein, kann zuweilen im Bereich der Notwendigkeit liegen. Zuerst kostete er von der Suppe, dann reichte er sie sofort an mich weiter. Er machte ein etwas merkwürdiges Gesicht. Ich fragte ihn, wie die Suppe denn sei, aber er sagte, ich solle doch einfach mal probieren. Doch da sah ich schon, wie sich die Jungen ringsum teils entsetzt, teils prustend vor Lachen anschauten. Ich habe dann auch einen Löffel voll genommen und musste finden, dass die Suppe in der Tat leider nicht essbar war. Ich habe den «Zierlederer» gefragt, was wir machen sollten, und er hat gesagt, von ihm aus könne ich sie ruhig ausgießen. Zur gleichen Zeit ertönte von hinten eine heitere Stimme, die uns aufklärte: «Das ist sogenanntes Dörrgemüse », sagte sie. Ich erblickte einen untersetzten, schon erfahrenen Mann, unter seiner Nase die weißliche Spur eines ehemaligen eckigen Schnurrbarts, das Gesicht voll wohlmeinenden Wissens. Es standen noch ein paar andere um uns herum, mit angewiderter Miene Napf und Löffel festhaltend, und ihnen erzählte er, dass er schon an dem früheren, dem gegenwärtigen vorangegangenen Weltkrieg teilgenommen hatte, und zwar als Offizier. «Da hatte ich genügend Gelegenheit», so berichtete er, «dieses Essen gründlich kennenzulernen, und zwar im Kreis der deutschen Kameraden an der Front, mit denen wir uns damals gemeinsam schlugen» – so hat er es formuliert. Für ungarische Mägen sei solches gedörrtes Gemüse – so hat er mit einem irgendwie verständnisvollen, gewissermaßen nachsichtigen Lächeln hinzugefügt – natürlich ungewohnt. Doch er hat uns versichert, dass man sich daran gewöhnen könne, ja, seines Erachtens auch solle, da es viele «Nährstoffe und Vitamine» enthalte, wofür, so erklärte er, das Dörrverfahren und die Kundigkeit der Deutschen auf diesem Gebiet bürgten. «Und überhaupt», bemerkte er mit erneutem Lächeln, «für den guten Soldaten ist das erste Gebot: Alles essen, was es heute gibt, denn wer weiß, ob es auch morgen etwas geben wird», das waren seine Worte. Und dann hat er tatsächlich seine Ration ausgelöffelt, gleichmäßig, ruhig, ohne eine Miene zu verziehen, bis zum letzten Tropfen. Meine Ration habe ich dann doch an der Barackenwand ausgeleert, so wie ich es von einigen Erwachsenen und Jungen gesehen hatte. Aber ich kam in Verlegenheit, weil ich von weitem den Blick unseres Vorstehers sah und besorgt war, dass es ihn vielleicht kränken könnte; doch es war da nur wieder dieser eigentümliche Ausdruck, dieses unbestimmte Lächeln auf seinem Gesicht, wie ich flüchtig festzustellen meinte. Ich habe dann das Geschirr zurückgebracht und dafür eine dicke Scheibe Brot erhalten, darauf eine weiße Masse, die einem länglichen Klotz aus dem Baukasten ähnelte und auch ungefähr so dick war: Butter – nein, Margarine, wie es hieß. Das habe ich dann verspeist, obgleich ich auch solches Brot noch niemals gesehen hatte: viereckig und als wären die Rinde und das Innere aus dem gleichen schwarzen Schlamm gebacken, mit Strohhalmen und Körnchen dazwischen, die unter den Zähnen knirschten; aber immerhin, es war Brot, und ich hatte auf der langen Reise schließlich doch Hunger bekommen. Die Margarine verstrich ich mangels eines besseren Werkzeugs mit dem Finger, so nach Robinsonart, gewissermaßen, im Übrigen genau so, wie ich es bei den anderen gesehen hatte. Dann sah ich mich nach Wasser um, doch unangenehmerweise stellte sich heraus, dass es keines gab: Ich war ganz schön ärgerlich, na, nun durften wir also wieder Durst haben, genau das Gleiche wie in der Eisenbahn.
Zu dieser Zeit mussten wir, nun aber ganz ernsthaft, auf den Geruch aufmerksam werden. Es wäre schwer, ihn genau zu umschreiben: süßlich und irgendwie klebrig, auch das nun schon bekannte chemische Mittel darin, aber so, dass ich schon fast ein bisschen Angst hatte, das erwähnte Brot würde sich wieder in meiner Kehle zurückmelden. Es fiel uns nicht schwer festzustellen: Ein Schornstein war der Sünder, auf der linken Seite, in Richtung der Landstraße, aber noch viel weiter weg. Es war ein Fabrikschornstein, das sah man gleich, und so haben es die Leute auch von unserem Vorsteher in Erfahrung gebracht, und zwar der Schornstein einer Lederfabrik, wie viele auch gleich wussten. Tatsächlich, da fiel mir wieder ein, wenn ich am Sonntag mit meinem Vater ein Fußballspiel in Újpest besucht hatte, war die Straßenbahn an einer Lederfabrik vorbeigekommen, und da musste ich mir auch jedes Mal die Nase zuhalten. Im Übrigen – ging die Nachricht – würden wir zum Glück nicht in dieser Fabrik arbeiten müssen: Wenn alles gutging, wenn kein Typhus, keine Ruhr oder sonst eine Epidemie unter uns ausbrach, dann würden wir bald, so beruhigte man uns, zu einem freundlicheren Ort aufbrechen. Deshalb trügen wir auch auf den Kleidern, vor allem aber auch auf der Haut noch keine Nummer wie etwa unser Kommandant, der «Blockälteste» , wie man ihn jetzt schon nannte. Von dieser Nummer hatten sich übrigens viele mit eigenen Augen überzeugt: Sie sei – so wurde verbreitet – mit grüner Tinte auf sein Handgelenk geschrieben und mit den Stichen einer besonderen Nadel unauslöschlich hineinpräpariert, eintätowiert, wie es hieß. Ungefähr zur gleichen Zeit ist mir auch der Bericht der freiwilligen Suppenholer zu Ohren gekommen. Auch sie hatten, in der Küche, die Nummern gesehen, und auch die waren Gefangenen, die schon länger hier weilten, in die Haut eingeritzt. Vor allem ging die Antwort von Mund zu Mund und wurde auf ihren Sinn hin untersucht und immer von neuem wiederholt, die ein Gefangener gegeben hatte, als einer unserer Leute wissen wollte, was das sei. «Die himmlische Telefonnummer» , soll angeblich dieser Gefangene gesagt haben. Wie ich sah, gab die Sache allen ziemlich zu denken, und obwohl ich aus diesen Worten nicht recht klug wurde, mussten sie auch mir, zweifellos, seltsam erscheinen. Auf jeden Fall haben die Leute daraufhin begonnen, sich um den Blockältesten und seine beiden Gehilfen zu scharen, hin und her zu laufen, sie auszufragen, mit Fragen zu belagern und das Erfahrene rasch untereinander auszutauschen, so zum Beispiel die Frage betreffend, ob es Epidemien gebe. «Ja», lautete die Auskunft. Und was mit den Kranken geschehe. «Sie sterben.» Und mit den Toten? «Die werden verbrannt», erfuhren wir. Genau besehen – so stellte sich allmählich heraus, ohne dass ich genau hätte verfolgen können, auf welchem Weg – war der Schornstein dort gar nicht wirklich eine Lederfabrik, sondern es war ein «Krematorium» , das heißt der Schornstein eines Einäscherungsofens, wie man mich über die Bedeutung des Wortes aufklärte. Da habe ich ihn mir noch etwas genauer angeschaut: Es war ein gedrungener, eckiger Schornstein mit einer breiten Öffnung, oben wirkte er wie plötzlich abgeschlagen. Ich kann sagen, dass ich, abgesehen von einer gewissen Ehrfurcht – nun ja, und abgesehen vom Geruch, natürlich, in dem wir schon förmlich stecken blieben wie in irgendeinem Matsch, einem Sumpf –, sonst nicht sehr viel spürte. Doch dann konnten wir zu unserer erneuten Überraschung in der Ferne noch einen, dann noch einen und dann, schon am Rand des leuchtenden Himmels, noch einen solchen Schornstein ausmachen, wobei aus zweien ähnlicher Rauch quoll wie aus dem unsrigen, und vielleicht hatten jene recht, denen auch die entfernten Rauchschwaden, die hinter einer Art kümmerlichem Wäldchen aufstiegen, allmählich verdächtig vorkamen und bei denen, meines Erachtens berechtigterweise, die Frage auftauchte, ob die Epidemie wohl solche Ausmaße habe, dass es so viele Tote gab.
Читать дальше