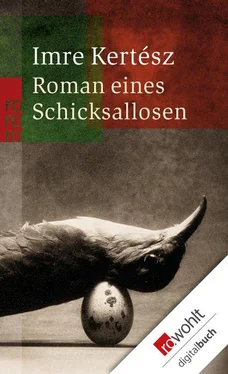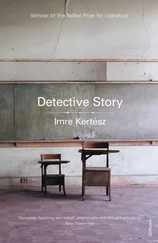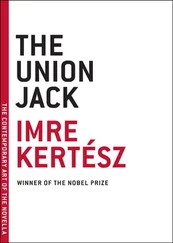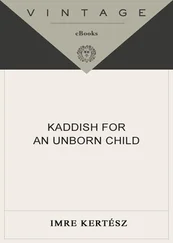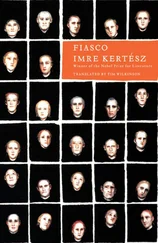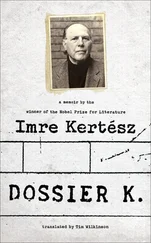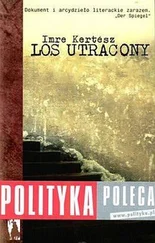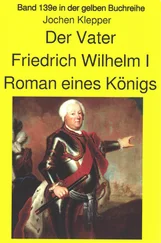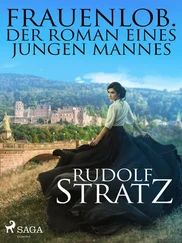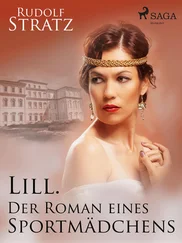Dann gab es auch Misstrauischere, die anders informiert waren und von anderweitigen Eigenschaften der Deutschen zu wissen meinten; wieder andere, die also in diesem Fall einen besseren Rat von ihnen haben wollten; und wieder andere, die sich anstelle solchen Gezänks für die Stimme der Vernunft, für ein beispielhaftes Verhalten und würdiges Auftreten vor den Behörden aussprachen – und all diese Argumente und Gegenargumente, aber auch zahlreiche weitere Neuigkeiten, Informationen und Hinweise wurden auf dem Hof ringsum unablässig diskutiert, in kleineren oder größeren Gruppen, die sich fortwährend auflösten und dann wieder von neuem bildeten. Ich hörte, dass unter anderem sogar Gott erwähnt wurde, «Sein unergründlicher Ratschluss» – wie es einer von ihnen formulierte. Wie einst Onkel Lajos, so sprach auch er von Schicksal, vom Schicksal der Juden, und er war, gleicherweise wie Onkel Lajos, der Ansicht, wir seien «vom Herrn abgefallen», und das sei die Erklärung für die Heimsuchungen, die uns ereilten. Er hat dann doch ein wenig meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn er war ein kraftvoll auftretender und auch körperlich so beschaffener Mann, mit einem ziemlich ungewöhnlichen Gesicht, das von einer schmalen, aber weit ausholend gebogenen Nase geprägt wurde, sehr glänzenden, feucht blickenden Augen, einem schönen, grau durchzogenen Schnurrbart und einem damit zusammengewachsenen kurzen runden Kinnbart. Ich sah, dass immer viele um ihn herumstanden und gespannt seinen Worten lauschten. Erst später habe ich erfahren, dass er Geistlicher war, denn ich hörte, wie man ihn mit «Herr Rabbi» anredete. Ich habe mir auch ein paar seiner besonderen Worte oder Ausdrücke gemerkt, so zum Beispiel die Stelle, wo er zugab – «denn das Auge, das sieht, und das Herz, das fühlt» gäben ihm Anlass zu diesem Zugeständnis –, dass «wir hienieden das Maß der Strafe vielleicht in Frage stellen mögen» – und seine sonst klare, tragende Stimme versagte ihm hier für einen Augenblick, während seine Augen noch feuchter wurden als sonst. Ich weiß nicht, warum ich da das merkwürdige Gefühl hatte, er habe ursprünglich eigentlich etwas anderes sagen wollen und seine Worte hätten ihn selbst ein bisschen überrascht. Doch er fuhr dann fort und gestand, «er wolle sich über nichts hinwegtäuschen». Er wisse schon, er müsse sich «an diesem Ort der Pein und unter diesen gequälten Gesichtern» ja nur umschauen – wie er sagte, und ich war von seinem Mitleid etwas überrascht, denn schließlich war er selber ja auch hier –, um zu sehen, wie schwer seine Aufgabe sei. Doch sein Ziel sei es nicht, «Seelen zu gewinnen für den Allmächtigen», denn das sei nicht nötig, da ja unser aller Seelen Ihm entspringen, wie er sagte. Dabei rief er uns aber auf: «Hadert nicht mit dem Herrn!», und zwar gar nicht einmal nur deshalb, weil das eine Sünde wäre, sondern weil dieser Weg «zur Verneinung des hohen Sinns des Lebens» führen würde und wir seiner Meinung nach «mit dieser Verneinung im Herzen» nicht leben könnten. Ein solches Herz möge wohl leicht sein, aber nur, weil es leer sei, gleich der Ödnis der Wüste, sagte er; schwer sei es hingegen und doch der einzige Weg der Tröstung, auch in den Heimsuchungen die unendliche Weisheit des Allmächtigen zu erkennen, denn, wie er wörtlich fortfuhr: «Die Stunde Seines Sieges wird kommen, und sie werden eins sein in Reue, und aus dem Staub werden sie Ihn anrufen, die Seine Herrschaft vergessen haben.» Und wenn er also jetzt schon sage, dass wir an das Kommen Seines künftigen Erbarmens glauben müssen («und dieser Glaube möge in dieser Stunde der Prüfung unsere Stütze und der unerschöpfliche Quell unserer Kraft sein»), so habe er damit auch schon die einzige Art und Weise bezeichnet, wie wir überhaupt leben könnten. Und diese Art und Weise nannte er die «Verneinung der Verneinung», da wir ohne Hoffnung «verloren» seien – während wir Hoffnung einzig aus dem Glauben schöpfen könnten und aus dem unverbrüchlichen Vertrauen, dass sich der Herr unser erbarmen werde und wir Seiner Gnade zuteil würden. Seine Beweisführung, ich musste es zugeben, schien klar, wobei mir doch auffiel, dass er alles in allem nicht sagte, wie wir da eigentlich etwas Konkreteres tun könnten, und er war auch nicht recht imstande, denen mit einem guten Rat zu dienen, die ihn um seine Meinung angingen: ob sie sich jetzt schon für die Reise melden oder lieber noch dableiben sollten. Auch den Pechvogel habe ich da gesehen, und zwar gleich mehrere Male: Einmal tauchte er bei der einen Gruppe auf, dann bei der anderen. Ich habe aber bemerkt, dass er unterdessen seine winzigen, noch ein wenig blutunterlaufenen Augen immerzu unruhig und unermüdlich auch über andere Leute und Gruppen schweifen ließ. Hin und wieder vernahm ich auch seine Stimme, wenn er da und dort jemanden anhielt und von ihm mit krampfhaft forschendem Gesicht, während er sich die Finger zerrte und knetete, wissen wollte: «Verzeihung, reisen Sie auch?», und: «Warum?», und: «Ist das Ihres Erachtens besser, gestatten Sie die Frage?»
Gerade da – erinnere ich mich – ist ein anderer Bekannter aus dem Zollhaus, der «Experte», gekommen, um sich anzumelden. Ich habe ihn in der Ziegelei-Zeit auch sonst öfter gesehen. Seine Kleidung war zwar zerknittert, seine Krawatte verschwunden und sein Gesicht voller grauer Stoppeln, aber im Großen und Ganzen waren an ihm auch so noch alle die unzweifelhaften Anzeichen einer Respektsperson zu erkennen. Seine Ankunft hatte sofort Aufsehen erregt, denn es war ein Kreis von aufgeregten Menschen um ihn herum, und er vermochte die vielen Fragen, mit denen sie ihn bestürmten, kaum zu beantworten. Wie nämlich auch ich sehr bald erfuhr, war es ihm möglich gewesen, geradewegs mit einem deutschen Offizier zu sprechen. Das Ereignis hatte sich vorn, bei den Büros der Kommandantur, der Gendarmerie und anderer Untersuchungsbehörden, zugetragen, wo ich in diesen Tagen auch hin und wieder das schnelle Verschwinden oder Auftauchen einer deutschen Uniform feststellen konnte. Zunächst – so war seinen Worten zu entnehmen – hatte er es mit den Gendarmen versucht. Er hatte sich, wie er sagte, bemüht, «Verbindung mit der Firma aufzunehmen». Doch wie wir nun erfuhren, hatten ihm die Gendarmen dieses Recht «beharrlich verweigert», obwohl «es sich um die Rüstungsindustrie handelt» und «die Leitung der Produktion ohne ihn undenkbar ist», was auch die Behörden erkannt hatten, wenn er freilich des dahin lautenden Dokuments ebenso wie alles Übrigen auf der Gendarmerie «verlustig gegangen» sei: All das konnte ich nur eben so schlecht und recht mitverfolgen, weil er es bruchstückhaft erzählte, während er die vielen durcheinander gestellten Fragen beantwortete. Er schien recht aufgebracht. Doch er wolle nicht, so bemerkte er, «auf Einzelheiten eingehen». Im Übrigen hatte er sich ebendeswegen an den deutschen Offizier gewandt. Der Offizier sei im Begriff gewesen wegzugehen. Zufällig, so haben wir von ihm erfahren, hatte sich auch der «Experte» gerade in der Nähe aufgehalten. «Ich habe mich ihm in den Weg gestellt», sagte er. Übrigens waren mehrere Zeugen des Vorfalls zugegen, und sie erwähnten denn auch seine Waghalsigkeit. Darauf hat er aber mit den Schultern gezuckt und gesagt, wer nichts wagt, der gewinnt nichts, und er habe auf jeden Fall «endlich mit jemand Zuständigem» sprechen wollen. «Ich bin Ingenieur», fuhr er fort, «und ich beherrsche das Deutsche perfekt», fügte er hinzu. Das alles habe er auch dem deutschen Offizier gesagt. Er habe ihm zur Kenntnis gebracht, dass «man ihm seine Arbeit hier moralisch und auch de facto unmöglich macht», und zwar, in seinen Worten: «ohne jedwede Rechtskraft und Berechtigung, selbst im Rahmen der gegenwärtig bestehenden Verfügungen». «Wer hat denn davon etwas?», so habe seine Frage an den deutschen Offizier gelautet. Er habe ihm, so wie er nun auch uns wissen ließ, gesagt: «Ich suche nicht um Vorteile oder Privilegien nach. Aber ich bin jemand, und ich kann etwas: Ich möchte meinen Fähigkeiten gemäß arbeiten, das ist mein ganzes Bestreben.» Der Offizier hatte ihm daraufhin geraten, sich unter die Freiwilligen zu reihen. Er habe ihm, wie er sagte, keine «großartigen Versprechungen» gemacht, ihm aber versichert, dass Deutschland bei seiner gegenwärtigen Kraftanstrengung einen jeden brauche, ganz besonders aber die Sachkenntnis von fachlich Ausgebildeten. Und wie wir von ihm erfuhren, hatte er deshalb, wegen dieser «Sachlichkeit» des Offiziers, das Gefühl, dass das, was dieser gesagt habe, «korrekt und real» sei – mit diesen Worten hat er es bezeichnet. Er hat auch noch eigens die «Manieren» des Offiziers erwähnt: Im Gegensatz zur «Ungeschlachtheit» der Gendarmen beschrieb er ihn als «nüchtern, gemäßigt und in jeder Hinsicht einwandfrei». Auf eine andere Frage räumte er ein, es gebe «keine weitere Garantie» als lediglich diesen seinen Eindruck von dem Offizier; doch er sagte auch, im Augenblick müsse er sich damit begnügen, und er glaube nicht, sich geirrt zu haben. «Vorausgesetzt», sagte er noch, «dass mich meine Menschenkenntnis nicht trügt» – aber doch eher so, dass jedenfalls auch ich diese Möglichkeit als einigermaßen unwahrscheinlich empfand.
Читать дальше