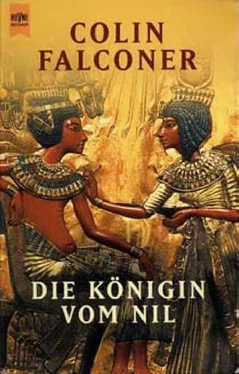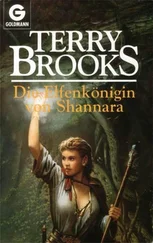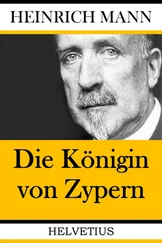Auf dem Wasser standen sich zwei Flotten gegenüber: Zwei-, Drei- und Vierruderer in Schlachtordnung. Die Fahnen von Ägypten und Tyros wehten von den Masten.
Wieder führte man Kleopatra zu einem Ehrenplatz, der sich direkt vor Caesar befand. »Ich hoffe, daß Euch das Schauspiel gefallen wird«, sagte er. »Ich habe die denkwürdige Schlacht nachstellen lassen, die einst zwischen der ägyptischen und tyrischen Flotte ausgefochten wurde.«
»Ist das auch nur Theater?«
»Aber nein, wo bliebe denn da der Spaß? Bei den Männern auf den Schiffen handelt es sich um Kriegsgefangene oder zum Tode Verurteilte. Sie kämpfen richtig um ihr Leben.«
Kleopatra spürte, wie sie eine seltsame Mattigkeit überfiel. Noch mehr Gemetzel. Wieviel Blut mußte denn nur fließen, bis sich diese Menschen zufriedengaben?
Caesar gab den Herolden ein Zeichen. Die Fanfaren ertönten, die Schiffe stießen vom Ufer ab und ruderten aufeinander zu. Sechstausend Männer, das Leben verwirkt, nur zum Vergnügen Roms.
Als sie dicht genug aufgefahren waren, griffen sie sich mit schweren bronzenen Rammböcken an. Über das Wasser flogen Enterhaken. Ein Brandpfeil wurde in einen der Vierruderer geschleudert und steckte ihn in Brand.
Die Menge auf der anderen Uferseite tobte, doch auch die Gäste auf der Tribüne schienen Gefallen an dem Schauspiel zu finden. Selbst die Senatoren in den Purpurroben waren aufgesprungen. Kleopatra wandte sich zu Caesar um. Er schien der einzige zu sein, der das Geschehen gelassen verfolgte, leicht amüsiert, wie gewöhnlich.
Eins der Schiffe war bereits im Begriff zu sinken. Auf dem Wasser trieben die ersten Leichen. Der Lärm war ohrenbetäubend: das Aufeinandertreffen stählerner Schwerter, splitterndes Bersten hölzerner Rumpfseiten, wenn die Rammsporne sie durchbohrten, anfeuerndes Gebrüll der Zuschauer, unter denen viele eine Wette auf den Schlachtausgang abgeschlossen hatten.
Kleopatra überlief ein Schauder, so heftig und beängstigend, wie sie es noch nie erlebt hatte. Es war, als hätte man ihr plötzlich eisiges Wasser übergegossen. Ihr war speiübel. Sie wußte jedoch, daß dieses Gefühl nichts mit dem Blutvergießen zu tun hatte, das sich vor ihren Augen abspielte.
Es ging nicht mehr. Kleopatra konnte nicht länger hinschauen. Sie sprang auf.
»Ihr verlaßt uns?« Caesars Stimme drückte Zorn und Enttäuschung aus.
»Ich fühle mich nicht wohl«, entgegnete sie und hastete mit ihrem Gefolge an den Zuschauern vorbei. Auch als die Sänfte das Marsfeld schon eine Meile hinter sich gelassen hatte, hörte sie noch den Schlachtenlärm, die Schreie der Sterbenden, roch den Rauch brennenden Holzes, des Leinens und Teers und spürte, wie sie abermals erschauerte.
Später würde sie sich an diesen Tag auf dem Marsfeld erinnern und wissen, daß Isis sie hatte warnen wollen, selbst damals schon.
Sie befanden sich tief unter der Stadt. Sie hörte, wie das kalte Wasser von den Felsen tropfte. Der Boden unter ihren Füßen war glitschig vor Blut. Der Henker richtete sich auf, dehnte und reckte die Muskeln. Ein großer, grobschlächtiger Kerl, mit fauligen Zähnen und toten Augen. Er wirkte erschöpft. Sein Schwert war befleckt mit schwarzem Blut.
Jetzt war sie an der Reihe.
Arsinoe spürte, wie sie die Kontrolle über sich verlor. Etwas Nasses rann an den Innenseiten ihrer Schenkel hinab. Das Atmen fiel ihr schwer, und sie spürte, wie ihre Beine nachgaben. Eine der Wachen mußte sie stützen. Bei Ganymedes hatten sie ihr Werk bereits getan. Der Zenturio stieß den enthaupteten Rumpf mit dem Fuß in den Brunnen. Mit einem Aufklatschen stürzte er in die Abwässerkanäle.
Ein Wachhauptmann trat vor. »Die nicht!« sagte er.
»Ich bleibe... am Leben?« flüsterte sie, wenngleich sie es nicht zu hoffen wagte.
»Ihr werdet nach Ephesos verbannt.«
»Meine Schwester... hat mich verschont?«
Das Gesicht verzerrte sich zu einem Grinsen. »Niemals. Wie es heißt, hat sie sich Euer hübsches Köpfchen in Essig eingelegt gewünscht. Es ist ein Befehl Caesars, und mir soll's recht sein. Wäre auch viel zu schade, so schöne Ware in die Cloaca Maxima zu werfen!«
Er und die anderen Henkersknechte brachen in brüllendes Gelächter aus.
6
Die Triumphe verteilten sich auf ein zehn Tage währendes Fest. Jeden Nachmittag fanden auf dem Marsfeld athletische Kämpfe und Wettspiele statt. Der Pontische Triumph, so fand man jedoch, war eine Enttäuschung nach den fiebrigen Höhepunkten des gallischen und der exotischen Darbietung Ägyptens.
Das Wetter war inzwischen hochsommerlich, und die vollgestopfte Stadt briet in der Glut der Tage. Anders als in Alexandria gab es keine sanfte Brise, die vom Meer wehte und Abkühlung brachte. Aus diesigen Wolkenbänken brannte die Sonne erbarmungslos auf die Wohnhäuser des Aventins, und die Stadt steckte unter einer Glocke des eigenen Schweißes und Gestanks.
Als schließlich der dritte Triumph gefeiert wurde, hatte sich bereits ein Gefühl des Überdrusses eingestellt. Kleopatra vernahm eine Stimme hinter sich, die sich in diesem Sinne äußerte, während man auf den Umzug wartete. »Das ist alles zuviel, zuviel für einen Menschen. Selbst für einen Gott wäre das zuviel.«
Sie wandte sich um. Die Stimme gehörte Marcus Brutus.
Als die Reihe dann endlich am letzten Triumph war, dem über Afrika, schien es, als ob sich selbst der unfehlbare Caesar verrechnet hatte. Wie Brutus ihm an jenem Abend vorgehalten hatte, war der afrikanische Krieg gegen die Söhne des Pompejus geführt worden - gegen römische Brüder. Caesars Behauptung, daß er gegen Juba und die Numider gekämpft habe, hatte niemanden überzeugt.
Die Paraden hatten etwas Gleichförmiges angenommen. Als die Senatoren und Magistrate erneut an der Tribüne vorbeizogen, neigte Mardian sich zu Kleopatra und grinste. »Seht nur die roten Köpfe, und wie sie keuchen«, flüsterte er.
»Wenn es nach ihnen ginge, brauchte Caesar sein Leben lang nicht mehr zu siegen.«
Natürlich gab es auch hier wieder Beute. Fuhrwerke, hoch beladen mit riesigen Elefantenzähnen, Käfige mit wilden Tieren, Leoparden und sogar Hyänen. Außerdem sah man Nomaden im Fellkostüm, die in Hörner stießen und kleine Trommeln schlugen. Auch dieses Schauspiel wirkte exotisch, und eine Zeitlang war es die Menge zufrieden und klatschte Applaus.
Dann kamen jedoch die Schauwagen. Die Räder ratterten schwer über die Pflastersteine. Sie führten Bildertafeln mit sich, auf denen die Schlachten lebensnah nachgestellt waren, die Flächen fast haushoch, mit leuchtenden Farben. In seinem Hochmut hatte Caesar sogar den Tod seiner römischen Gegner aufmalen lassen, darunter ein riesiges Bildnis des sterbenden Cato, mit herausquellenden Eingeweiden.
Bei diesem Anblick verfiel die Menge in Schweigen.
Da Juba genau wie die anderen Feinde nicht mehr unter den Lebenden weilte, war nur noch ein Kriegsgefangener übriggeblieben. Jubas Sohn, gerade einmal vier Jahre alt, stolperte, in silberne Ketten gelegt, an ihnen vorbei. Das Schweigen verwandelte sich in Buhrufe und Pfiffe. Es war ein beschämender Anblick. Ein Kind zur Schau zu stellen war eigentlich unter Caesars Würde. Hatte er das Maß der Dinge verloren? fragte sich Kleopatra, oder zeigte er damit etwa seine Verachtung für diese Form des Ruhms? Oder sogar gegenüber Rom selbst?
Am selben Abend wurde Caesar in einer Sänfte zwischen zwei Elefanten durch ein Fackelspalier zum Capitol getragen. Dort brachte er Jupiter seine Opfer dar und dankte im römischen Pantheon für den siegreichen Ausgang seiner Taten. Anschließend feierte Rom abermals auf seine Kosten. Im Forum waren unzählige Tische aufgestellt, an denen das Volk bewirtet wurde. Tänzer und Gaukler dienten der Unterhaltung. Im Verlauf der Sommernacht wurde die Via Sacra allmählich erfüllt von singendem und johlendem Gebrüll, Betrunkene lagen auf den Stufen der Kurie hingestreckt, und überall breiteten sich Weinlachen aus.
Читать дальше