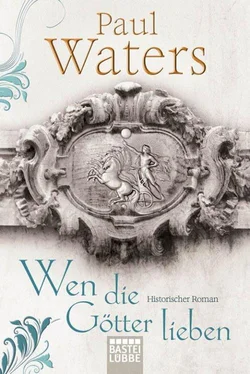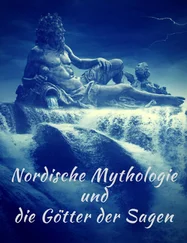Decentius mochte sich unbedarft geben, doch Julian blickte nun Sintula an, der genau wusste, dass der Abzug eines so großen Teils des Heeres den Cäsar stark geschwächt zurückließe. Sintula trat unruhig aufs andere Bein und starrte auf den Fußboden.
Oribasius und Eutherius waren oben im Arbeitszimmer geblieben, aber ich war bei ihm und Marcellus ebenfalls. Julian warf uns einen Blick zu; seine Anspannung war ihm anzusehen. Ich wusste, was er dachte: dass sein Feind am Hof ihn nun doch noch geschlagen hatte. Einen Moment lang wirkte er hoffnungslos. Dann aber straffte er die Schultern. Er war nicht gewillt, diesen überheblichen Notar merken zu lassen, wie sehr es ihn traf.
»Wie der Kaiser wünscht«, sagte er schließlich.
»Selbstverständlich«, erwiderte der Notar mit hochgezogenen Brauen. Er gab dem Diener ein Zeichen, aber Julian war noch nicht fertig.
»Allerdings befinden sich die Heruler und Bataver zusammen mit dem Heermeister in Britannien«, sagte er. »Und Florentius, der die Versorgung der Truppen sicherzustellen hat, ist nach Vienne gereist. Daher wird die Sache warten müssen, fürchte ich. In der Zwischenzeit wird Sintula sein Bestes tun, um dir den Aufenthalt in Paris angenehm zu machen.«
Er wandte sich Marcellus und mir zu. »Kommt«, sagte er angespannt, »diese Männer haben nun viel zu tun, wenn sie die Provinz ihrer Verteidigungskräfte entledigen wollen, auf deren Aufbau wir so viel Mühe verwandt haben. Wir sollten sie ihrer Arbeit überlassen.«
Bevor noch jemand etwas sagen konnte, schritt er energisch davon und ließ den Notar stehen, der eine selbstgefällige Gleichgültigkeit zur Schau trug, während Sintula sich ein wichtiges Aussehen gab, aber dabei vergaß, den Mund zu schließen.
»Jeder Narr durchschaut, was er vorhat!«, rief Julian, als wir wieder in seinem Arbeitszimmer waren. »Er nimmt mir meine Streitkräfte, und dann wird er einen Haftbefehl schicken und mich festnehmen lassen. Und was ist mein Verbrechen? Dass ich tat, was von mir verlangt wurde, und Gallien befreit habe?«
Er sprach zu Eutherius, während er auf und ab schritt und aufgebracht gestikulierte. Nun aber wandte er sich Marcellus und mir zu.
»So dreht sich das Rad der Fortuna«, sagte er bitter. »Männer sind neidisch auf hohe Ämter und vergeuden ihr Leben, indem sie danach streben. Ihr seid loyale Freunde gewesen, aber ich kann euch nicht daran binden, da ich nun sehe, wohin es führen muss. Ihr müsst gehen, bevor ich verhaftet werde, sonst geratet ihr ebenfalls ins Netz.«
»Wir bleiben!«, erklärte Marcellus ohne Zögern.
Auf seine gewohnte beherrschte Art sagte Eutherius: »Lasst uns Ruhe bewahren … Mein lieber Julian, sei still und setz dich erst einmal.«
Julian ließ sich in den hochlehnigen Ebenholzstuhl fallen, der an der Wand stand, und rieb sich das Gesicht. Dann blickte er Eutherius an.
»Was nun?«, fragte er.
»Das ist eine alte Taktik. Der gehetzte Hase rennt immer ins Netz, doch der Mensch besitzt die Gabe der Vernunft. Deine Feinde bei Hof versuchen, dich in eine Falle zu treiben. Sieh es, wie es ist, und gib ihnen nicht den Vorwand, den sie brauchen. Fürs Erste verhalte dich einwandfrei.«
Eutherius erteilte seine Ratschläge, und Julian hörte zu. Anschließend sandte er mit dem kaiserlichen Kurierdienst eine Depesche nach Vienne, in welcher er Florentius mitteilte, dass er in Paris verlangt werde und wichtige Angelegenheiten mit ihm zu besprechen habe. Inzwischen ließ der Notar Decentius von Sintula die Auswahl unter den Soldaten treffen.
Als Sintula mit seiner Aufgabe begann, kam Marcellus aus der Kaserne und berichtete mit schiefem Lächeln: »Es wird schwieriger für ihn, als er geglaubt hat. Die Männer wollen nicht gehen. Sie wenden ein, dass sie keinen Befehl von Julian haben. Und sie mögen Sintula nicht. Er ist ihnen zu arrogant.«
Bald kam Sintula, um sich bei Julian zu beschweren; er brachte Decentius und seinen neuen Verbündeten Pentadius mit, einen von Florentius’ Klienten, den Julian nicht leiden konnte.
»Die Männer wollen nicht gehen«, sagte er empört. »Sie behaupten, du hättest ihnen versprochen, dass sie jenseits der Alpen nicht zu dienen brauchen.«
»So ist es. Du warst dabei, Sintula, oder hast du das vergessen? Ich versprach, dass sie niemand je zwingen wird, Gallien zu verlassen. Ich sagte, dass sie für Heim und Familie kämpfen. Wie wären sie mir sonst gefolgt, nachdem der Kaiser keine Mittel mehr aufbrachte, um sie zu bezahlen? Und hast du vergessen, dass du damals einverstanden warst?«
»Ich habe Befehle befolgt.«
»Und jetzt befolgst du wieder Befehle. Gewiss wirst du das den Männern erklären können.«
»Du sperrst dich also?«, fragte Decentius.
»Ich habe den Männern mein Wort gegeben.«
»Du hättest ein solches Versprechen niemals geben dürfen. Dazu warst du nicht befugt.«
»Der Kaiser gab mir den Auftrag, die Provinz zu sichern. Das war meine Befugnis. Wenn Constantius mich jetzt ersetzen will, soll er es tun. Ich bin bereit zu gehen.«
»Lass uns wenigstens erklären, dass du nichts einzuwenden hast!«, rief der kriecherische Pentadius aus.
Julian drehte sich zu ihm um und betrachtete ihn mit Abscheu. Pentadius gehörte zu denen, die von der Philosophie so wenig gelernt hatten, dass es besser gewesen wäre, sie hätten gar nichts gelernt. Er hatte irgendwo aufgeschnappt, dass der Mittelweg stets der beste sei, ohne zu begreifen, wie und warum. Jetzt sah er sich als Vermittler, blind gegenüber der Tatsache, dass er lediglich seine Laufbahn in der kaiserlichen Ämterhierarchie förderte, wie er es immer getan hatte.
»Du darfst ihnen sagen, ich hätte keine Einwände«, erklärte Julian. Er schritt zu den Bücherborden neben seinem Schreibpult, betrachtete die unordentlich gestapelten Schriftrollen mit ihren Schildchen und hölzernen Spindeln und drehte sich dann um. »Sei aber beim nächsten Mal nicht überrascht, wenn sich keine Freiwilligen melden, wenn du in Gallien Männer rekrutieren willst.«
Tage vergingen. Von Florentius kam keine Antwort. Julian schickte eine zweite Depesche: Aus der Provinz sollten Truppen abgezogen werden, sodass er in Paris gebraucht werde. Es sei die Pflicht des Präfekten, für Ausrüstung und Transport zu sorgen.
»Er wird nicht kommen«, sagte Julian später.
»Er weiß, dass wir ihn verdächtigen«, meinte Oribasius.
Julian schaute aus dem Fenster. Es regnete. »Mit gutem Grund. Seine Abwesenheit ist allzu passend.« Er schüttelte den Kopf. »Dennoch hat er seine Arbeit zu tun. Fürchtet er etwa um sein Leben? Er sollte mich besser kennen.«
Während der grauen Wintertage versuchten wir alle auf unterschiedliche Weise, beim Notar zu intervenieren; wir drängten ihn, die Sache aufzuschieben und um neue Befehle zu bitten.
Just nach solch einem unerfreulichen Gespräch – der Mann war für vernünftige Überlegungen unzugänglich und auf aggressive Weise stur – lief ich Eutherius in die Arme, als er die Gartenkolonnade entlangging.
Er nahm mich beim Arm und lud mich ein, einen Becher Wein mit ihm zu trinken. Als wir in seinen warmen, süß duftenden Gemächern saßen und Agatho uns den Wein gebracht hatte, sagte ich: »Es nützt nichts, er will nicht zuhören. Man könnte ebenso gut mit einem Stein reden.«
»Das kann uns schwerlich überraschen, Drusus. Aber jetzt nimm dir erst einmal einen von diesen wunderbaren Zimtkuchen, und mach nicht so ein verdrießliches Gesicht.«
Ich nahm einen Kuchen aus der kegelförmigen roten Glasschüssel. In Eutherius’ Zimmer stand immer eine Auswahl kleiner Köstlichkeiten bereit.
»Es ist klar, dass Decentius nicht die Absicht hat, unsere Ratschläge zu befolgen. Er ist nicht gekommen, um zuzuhören, sondern um Anweisungen zu erteilen. Aber«, sagte er nachdenklich kauend, »hast du bemerkt, dass er hinter seinem aufgeblasenen Gehabe gar nicht so selbstsicher ist, wie er vorgibt?«
Читать дальше