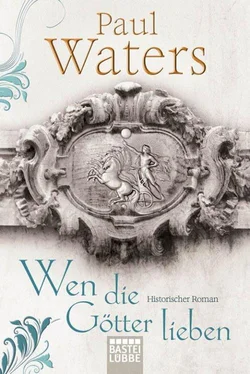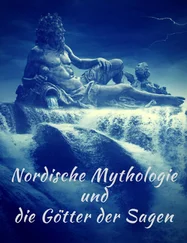»Wie es scheint, sind unsere Freunde auf Schwierigkeiten gestoßen«, sagte Julian, der meinen Blick auffing und sich seine Belustigung kurz anmerken ließ. »Drusus, vielleicht möchtest du ihnen unterbreiten, was deiner Ansicht nach getan werden kann – denn meine Meinung gefällt ihnen offenbar nicht.«
So wiederholte ich, was schon viele Male gesagt worden war: dass die Loyalität der Männer Gallien galt, wo sie geboren waren und wo ihre Familie lebte; dass sie während der vergangenen Jahre unter Julians Führung allen Widrigkeiten zum Trotz verteidigt hatten, was ihnen gehörte, und dass sie nicht willens waren, die Heimat zu verlassen.
»Ihre Loyalität muss dem Kaiser gelten«, schnauzte Decentius, um mich zum Schweigen zu bringen.
»Und was ist mit der soldatischen Disziplin?«, fragte Sintula.
»Sie fühlen sich betrogen. Sie haben ein Versprechen erhalten.«
Decentius schnaubte. »Dieses Versprechen hätte nicht gegeben werden dürfen. Ich will nichts mehr davon hören.« Plötzlich fuhr er Sintula an: »Warum hast du nicht weitermarschieren lassen? Soll ich etwa glauben, du seist unfähig, eine Kraftprobe mit einer Horde Weiber zu gewinnen?«
Sintula wurde rot. »Aber Notar! So war es nicht. Die Männer hätten eine Meuterei angefangen!«
»Er hat recht, es wäre zum Aufruhr gekommen«, bestätigte ich, aber nicht um seinetwillen, denn er war mir zu ehrgeizig. Als Soldat wusste er genau, was geschehen wäre, hätte er weitermarschieren lassen. Decentius dagegen schwelgte in dem Mut eines Mannes, der noch keine Schlacht erlebt hat.
Nebridius, der sich bisher nicht geäußert hatte, fragte mit ruhiger Stimme: »Was nun?«
Stille trat ein. Alle Blicke richteten sich auf Julian. Als Decentius dies sah, rief er: »Ihr könnt doch die Lösung nicht von ihm erwarten!«
»Fällt dir etwas Besseres ein?«, fragte Nebridius.
Decentius bedachte ihn mit einem wütenden Blick. Man gab einem kaiserlichen Notar keine Widerworte, es sei denn, man sehnte sich nach dem Tod. Aber Marcellus, der solche Männer verachtete, sagte: »Julian kennt die Soldaten. Du nicht.«
Decentius fuhr zu ihm herum wie ein bösartiger, in die Enge getriebener Hund. Marcellus erwiderte kühl seinen Blick. Dann sagte Julian: »Du kannst nur eines tun, Notar: Du musst den Männern erlauben, ihre Frauen und Kinder mitzunehmen. Das ist die einzige Möglichkeit.«
»Das ist absurd!«
»Dann tu, was du willst. Du hast diese Schwierigkeiten selbst herbeigeführt. Begreifst du denn gar nicht, was heute beinahe passiert wäre? Ich schlage vor, du denkst darüber nach.«
Julian wandte sich Nebridius zu, der mehr Vernunft besaß.
»Der Quartiermeister wird dir Wagen für die Frauen geben. Du solltest sie lieber von Paris wegbringen lassen, bevor die anderen Einheiten eintreffen.«
Zwei Tage später brachen die Soldaten auf, eine mürrische Schar entmutigter Männer, angeführt von einem jämmerlichen Tribun und gefolgt von Karren mit zerlumpten Frauen, die sich gegen die Kälte eingemummt hatten.
Während der Vorbereitungen war Decentius in seiner Unterkunft in der Zitadelle geblieben. Doch jetzt, wo die Truppen abmarschierten, zeigte er sich wieder. Völlig unverdrossen, voll törichter Selbstgewissheit schritt er mit Pentadius umher, als hätte er einen Sieg errungen. Er beschwerte sich bei Julian, dass von Lupicinus noch immer keine Nachricht gekommen sei, dessen Legionen er schließlich angefordert habe. Und warum der Präfekt nicht gekommen sei, wollte er wissen. Die verbliebenen Truppen seien noch in ihren abgelegenen Winterquartieren; er könne nicht länger warten. Julian selbst müsse den Befehl erteilen, dass sie sich in Paris einzufinden hätten.
Bei dem Wortwechsel war Julian mit ihm allein. Als er Oribasius und mir später davon berichtete, sagte er: »Er wirft mir vor, dass ich nicht mit ihm an einem Strang ziehe. Er gibt mir die Schuld an dem Ärger mit den Frauen und sagt, ich täte besser daran, dem Kaiser meine Treue zu beweisen. Er macht sich nicht einmal die Mühe, seine Drohung zu verschleiern.«
Er seufzte und machte eine hoffnungslose Geste. Dabei sah er plötzlich sehr jung aus, fand ich, wie ein unglücklicher Knabe. »Bei Gallus war es genauso«, sagte er.
Gallus war sein älterer Bruder gewesen. Auch er war in Abgeschiedenheit aufgewachsen, auf einem abgelegenen Gut in Asien – bis Constantius beschloss, dass er ihn brauchte. Er erhob ihn, der zum Herrschen nicht erzogen worden war, zum Cäsar, wie zuletzt auch Julian. Doch da endeten die Gemeinsamkeiten der beiden Brüder. Gallus’ Charakter war nicht durch gute Erziehung geschliffen und geformt worden. Da niemand ihm Mäßigung beigebracht hatte, war er machttrunken geworden, bis Constantius ihn schließlich aus dem Amt entfernte, indem er zuerst seine Truppen abzog und ihn dann zu »Beratungen« an den Hof rief. Die Beratungen waren eine Lüge gewesen: Unterwegs wurde er verhaftet, ohne Prozess verurteilt und enthauptet.
Julian erwähnte ihn selten. Ich nehme an, dass es ihn beschämte. Dennoch war Gallus sein Bruder und bei all seinen Fehlern sein letzter Verwandter gewesen.
Ins Griechische wechselnd sagte er leise: »Und er fiel durch blutigen Tod und mächtiges Verhängnis.«
»So heißt es bei Homer«, sagte Oribasius. »Aber das ist nur dann dein Schicksal, wenn du es wählst.«
Julian hörte ihm zu, erwiderte aber nichts. Lange Zeit stand er schweigend am Fenster und blickte in den Hof und auf die kahlen Obstbäume. Im Westen kam Wind vom Meer auf, brachte die Wolken in Bewegung und trieb den Regen fort. Immer breiter drangen die Sonnenstrahlen durch und verbreiteten goldenes Licht.
Julian war tief in Gedanken versunken. Schließlich drehte er sich mit einem kaum merklichen Nicken zum Zimmer hin um und blickte zum Tisch. Dort lag vergessen die Karte mit der Rheingrenze. Einen Moment lang betrachtete er sie wie ein alter Mann, der an seine Jugend zurückdenkt.
»Es wird bald Frühling«, sagte er. »Ich hatte große Pläne.«
Oribasius setzte zum Sprechen an, doch Julian hob die Hand.
»Nein, mein Freund, ich weiß, was du denkst. Du brauchst es nicht zu sagen. Wir haben getan, was wir tun mussten, und wir wissen beide, dass es Verrat bedeutet, sich dem Kaiser zu verweigern. Es ist besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun.«
Nicht lange danach sah ich bei meiner Rückkehr von einer Erledigung Marcellus im Garten der Zitadelle. Rufus war bei ihm.
Seit er zu Nevitta gewechselt war, hatte ich ihn kaum gesehen. Es erschütterte mich, wie sehr er sich verändert hatte. Nevittas Männer waren laut und prahlerisch, und Rufus hatte ihr nassforsches Auftreten übernommen. Es stand ihm schlecht. Und seinem blassen, unausgeschlafenen Gesicht nach zu urteilen, hatte er sich auch in ihre Gewohnheit hineinziehen lassen, nächtelang zu trinken. Seine jugendliche Frische war verschwunden. Seine schwarzen Locken hatten den Glanz verloren.
Marcellus stand mit dem Rücken zu mir. Es war Rufus, der mich als Erster bemerkte.
»Drusus!«, rief er mir entgegen. »Hast du schon gehört? Ich war gerade dabei, es Marcellus zu erzählen. Julian hat die Männer aus den Winterquartieren herbefohlen.«
»Tatsächlich?«, sagte ich vorsichtig.
»Ja, und das ist noch nicht alles. Hör dir das an: Die Anweisung stammt von diesem dummen Notar … wie heißt er gleich? Decentius? Es wird Ärger geben. Das ist Nevittas Meinung.« Er lachte laut wie über einen Kasernenwitz; dann fuhr er fort: »Nevitta sagt, Julian ist dagegen, aber der Notar will nicht auf ihn hören. Ist das wahr?«
Ein Stück entfernt war ein Schreiber, der soeben den Garten durchquert hatte, stehen geblieben und schaute zu uns herüber. Ich runzelte die Stirn und wünschte mir, Rufus würde leiser sprechen. Wusste er denn nicht, dass die Zitadelle zur Brutstätte von Intrigen geworden war? Hinter den Säulen und geschlossenen Fensterläden konnte sonst wer stehen und uns belauschen. Ich fing Marcellus’ Blick auf. Es war schon gefährlich, auch nur den Namen des kaiserlichen Agenten in einem solchen Tonfall zu nennen. Begriff der Junge das denn nicht?
Читать дальше