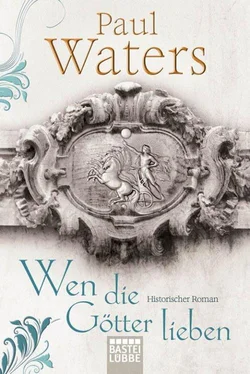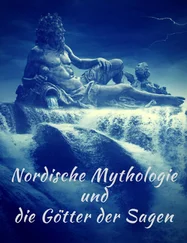Ich gab eine nichtssagende Antwort und riet ihm, nicht auf Gerüchte zu hören. Dann, um das Thema zu wechseln, sprach ich ihn auf seine neue Schimmelstute an. Nevitta hatte es gern, wenn seine Soldaten Pferde gleicher Farbe ritten; er hatte eine Vorliebe für das Protzige. Mit meiner Frage wollte ich Rufus auf sicheren Boden lenken, denn der Schreiber war nun in der gegenüberliegenden Kolonnade noch einmal stehen geblieben und tat so, als prüfte er das Bündel Papiere, das er bei sich trug.
Vor einiger Zeit noch hätten Rufus’ Augen bei der Erwähnung seines Pferdes aufgeleuchtet, doch nun zuckte er bloß die Achseln und erwiderte gleichgültig, das Tier sei scheu und schlecht erzogen. Sein Blick schweifte ab, und bald entschuldigte er sich und eilte davon, scheinbar mit der Absicht, seinen gefährlichen Klatsch weiter zu verbreiten.
Marcellus, der meine Gedanken gelesen hatte, sah ihm nach und wandte sich mir dann kopfschüttelnd zu.
»Gehen wir ein Stück«, sagte ich.
Wir sprachen erst wieder, nachdem wir unter dem Bogen durchgegangen und in den Pflaumengarten gelangt waren, wo uns niemand belauschen konnte.
»Hat Decentius den Verstand verloren?«, sagte Marcellus. »Er weiß, was bei der Palastgarde vorgefallen ist. Begreift er denn nichts?«
Julian hatte zwei Tage lang den Notar zu überzeugen versucht, die Männer anderswo und in kleineren Gruppen zusammenzuziehen, damit die Unzufriedenheit nicht um sich greifen konnte. Zuletzt hatte ich gehört, Decentius habe es am Ende eingesehen. Er musste seine Meinung wieder geändert haben, und Nevitta hatte es seinen Trinkkumpanen bereitwillig erzählt, als er davon erfuhr.
»Es sähe Decentius nicht ähnlich, von jemandem einen Rat anzunehmen«, sagte ich. »Er denkt, dass Julian nur seine Absichten vereiteln will.«
»Jeder Dummkopf kann erkennen, dass seine Vorgehensweise falsch ist.«
»Aber nicht Decentius. Er argwöhnt, dass Julian etwas im Schilde führt, und glaubt ihn überlistet zu haben.«
Marcellus schlug mit der Faust gegen die dunkle Rinde des Pflaumenbaums, an dem wir standen, und fluchte leise.
»Ich weiß«, sagte ich. »Er gießt damit Öl ins Feuer.«
Bald trafen die Einheiten nacheinander ein; die Petulantes als Erste, dann die keltischen Hilfstruppen und die Kohorten der anderen Legionen. Alle außer den Herulern und Batavern, die noch mit Lupicinus in Britannien waren.
Da sie für das Kastell auf dem Hügel zu viele waren, schlugen sie ihre Zelte außerhalb der Mauern auf den sanften Hängen am Flussufer auf. Julian begrüßte alte Kameraden und erinnerte sich gemeinsam mit ihnen an ihre tapferen Taten. Als sie sich beklagten, dass sie nach Osten marschieren sollten, gab er zu bedenken, dass es noch viele Siege zu erringen gelte und sie gewiss zu Ruhm und Reichtum gelangen würden. Die Männer hörten ihm respektvoll zu, weil sie ihn mochten. Doch ihre Gesichter verrieten, dass sie nicht überzeugt waren.
Decentius legte bei Julian Protest ein und sagte, er führe sich unmöglich auf. Doch ich war dabei. Hätte er mit dem Brauch gebrochen und sich nicht sehen lassen, wären die Soldaten sofort misstrauisch geworden. Sie hatten bereits dunkle Gerüchte gehört und waren bereit, alles Schlechte zu glauben, das ihnen zugetragen wurde.
Dann, an einem düsteren Wintermorgen, als das Heer zusammengezogen und abmarschbereit war, kam ich auf meinem Weg zu Julian an Decentius vorbei, der zornig über den Innenhof schritt. Bei ihm waren Pentadius und der Quästor Nebridius. Als ich bei Julian eintrat, sagte er: »Decentius ist soeben hier gewesen. Er hat beschlossen, den Tag des Abmarsches vorzuziehen.« Julian nahm ein Pergament vom Tisch und hielt es mir hin. »Hier, sieh dir das an. Das zirkulierte angeblich unter den Petulantes.«
Ich las. In ungelenker Handschrift standen da die altbekannten Klagen: dass die Männer gezwungen würden, ihre Familien zu verlassen; dass Versprechen gebrochen worden seien und dass die Barbaren nach dem Abzug der Soldaten wieder einfallen würden.
»Weißt du, wer das geschrieben hat?«, fragte ich und gab es Julian zurück.
»Decentius beschuldigt mich.«
Unsere Blicke trafen sich. Nach einem Moment schaute Julian achselzuckend zur Seite. »Ich werde sogar beschuldigt, wenn ich überhaupt nichts tue. Jetzt verlangt Decentius, dass ich die Offiziere ausfrage, um festzustellen, wie weit sich diese Ansichten verbreitet haben. Mit ihm will natürlich niemand reden … Darum habe ich alle Offiziere für heute Abend zu einem Bankett eingeladen. Komm auch, Drusus, und bring Marcellus mit.«
Die Petulantes und die Kelten waren Regimenter mit Männern aus Gallien, in denen auch einige barbarische Freiwillige dienten. Einige waren an die römische Lebensweise gewöhnt, andere nicht so sehr, insbesondere die Petulantes, die sich an ihre eigenen Bräuche hielten. Ihnen zu Gefallen lud er zu einem Festmahl, das eines Barbarenhäuptlings würdig gewesen wäre: Er ließ große Platten mit gebratenem Fleisch und stark gewürzten Soßen auftischen, dazu kräftigen gallischen Rotwein, der aus einem massiven Silberkrug ausgeschenkt wurde – einem prächtigen Ding mit Hirschreliefs, groß genug, um einen erwachsenen Mann aufzunehmen.
Für seinen genügsamen Gaumen dürfte das fette Essen widerlich gewesen sein. Doch er verstand es, seine Gäste zu bewirten, wenn es darauf ankam, und er leerte seinen Teller mit Hilfe des dankbaren Hundes, der mit wachen Augen unter der Liege ruhte.
Nachdem die schweren Platten abgetragen waren, befahl Julian, die Weinpokale noch einmal zu füllen, und schickte die Diener zu Bett. Erst dann fragte er nach der Stimmung unter den Soldaten.
Gelächter und Gespräche verstummten so schnell, wie Blei im Wasser versinkt. Jeder Offizier blickte seinen Nachbarn an, da er nicht als Erster antworten wollte.
»Es gibt ein Gerücht, wonach die Männer unzufrieden sind«, sagte Julian.
Dagalaif, der stattliche germanische Befehlshaber der Petulantes, stieß ein raues Lachen aus und schlug sich auf den Schenkel. Er gehörte zu Nevittas Freunden. Wie dieser hatte er während des Abends eine reichliche Menge getrunken.
»Unzufrieden!«, rief er und schaute spöttisch in die Runde. Er wollte gerade weitersprechen, als sein Blick auf Nevitta fiel, worauf er sich seine nächsten Worte verkniff. Ich schaute Nevitta an. Sein durchtriebenes Gesicht nahm einen nichtssagenden Ausdruck an. Er mochte derb sein, war aber auch berechnend. Er war kein Mann, der sich als Erster auf dünnes Eis wagt.
Wie weit Dagalaif das wusste, war mir nicht bekannt. Ich vermutete aber, dass er ihn in einem gewissen Maße durchschaut haben musste, denn er fuhr leiser und unsicherer fort: »Ich kann nur für meine eigenen Männer sprechen.«
»Dann sprich«, sagte Julian.
Dagalaif schaute stirnrunzelnd in die Runde und begegnete nur verschlossenen oder abgewandten Gesichtern. Er stellte seinen silbernen Pokal ab und wischte sich mit dem haarigen Unterarm den Mund ab. »Die Stimmung ist schlecht. Wenn du die Wahrheit hören willst: So schlecht gelaunt habe ich die Männer noch nie erlebt. Nicht einmal nach der Schlacht am Mons Seleucus.«
Von den anderen Liegen erklang beipflichtendes Gemurmel. Davon ermutigt, fuhr Dagalaif fort: »Sie sind gute, ehrliche Männer, Cäsar, das Salz der Erde, und sie fürchten keinen Kampf. Das weißt du. Aber es gefällt ihnen nicht, dass sie abbefohlen werden. Ein Versprechen muss man halten.«
Es folgte ein kurzes Schweigen. Dann öffneten sich die Schleusen, und plötzlich redeten alle durcheinander. Die Regimenter beklagten sich ausnahmslos, hieß es. Die Männer fühlten sich behandelt wie Verbrecher, die man aus ihrer Heimat ans Ende der Welt verbannte. Hätten sie dafür ihr Leben im Kampf aufs Spiel gesetzt? Julian sei ihr Befehlshaber, nicht Constantius. Die Männer wollten bei ihm bleiben. Sollte Constantius seine Kriege mit seinen eigenen Legionen führen.
Читать дальше