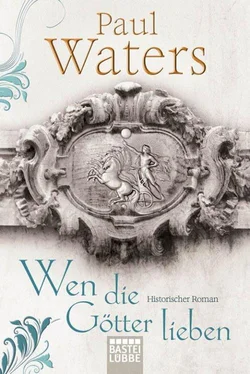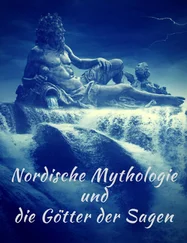Danach wurde Decentius zum Cäsar befohlen, war aber nicht auffindbar. Nachdem er sich ertappt gesehen hatte, war er wohl untergetaucht. Aber Paris ist ziemlich klein, und Decentius war als Spion des Kaisers verhasst, sodass er nicht lange unentdeckt blieb. Innerhalb von Stunden wurde er in den Palast zurückgebracht.
»Was willst du mit ihm machen?«, fragte Nebridius.
»Mit ihm machen? Nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass die Männer, die ihn fanden, ihn schon reichlich in Angst versetzt haben. Er hat Glück, dass er nicht mit durchgeschnittener Kehle im Fluss gelandet ist.«
»Und jetzt?«
»Er darf abreisen, wenn er will. Wir brauchen ihn hier nicht.«
Bald darauf kamen die Soldaten der Palastgarde zurück, die mit Sintula und ihren Frauen nach Osten gezogen waren. In ihrer Niedergeschlagenheit waren sie auf ihrem Marsch noch nicht weit gekommen, und sowie sie die Neuigkeiten aus Paris hörten, eilten sie zurück – auch Sintula, was ihm zur Ehre gereichte, denn er hätte leicht fliehen können.
Als halbwegs Ruhe eingekehrt war, befahl Julian, die Soldaten antreten zu lassen.
Er ritt aufs freie Feld vor der Stadt, wo die verschiedenen Einheiten lagerten, und unter quellenden Wolken und flüchtiger Frühlingssonne sprach er zu ihnen und führte ihnen vor Augen, was sie gemeinsam durchgestanden hatten. Nun hoffe er, sie würden in der Zeit seiner Bedrängnis zu ihm halten.
Der Jubel war laut und lang anhaltend. Die Männer hoben die Arme zum Gruß und schlugen mit den Speeren auf ihre glänzenden Schilde, dass es wie Donner durch die Reihen rollte. Sie waren bereit, Julians Befehlen zu folgen.
Später hielt er ein Gastmahl für seine Freunde ab. Vor uns bekannte er, was er insgeheim fürchtete. Seine Stellung in Gallien sei sicher, erklärte er, aber nur, weil der Kaiser an den Ostgrenzen mit den Persern beschäftigt sei. »Constantius muss begreiflich gemacht werden, dass die Akklamation nicht von mir ausging; ich fordere ihn nicht heraus. Die Männer waren nicht willens, Heimat und Familie zu verlassen. Das ist alles. Es ist kein Aufstand gegen ihn.«
»Constantius wird anderer Ansicht sein«, sagte Eutherius. »Schon jetzt glaubt er überall Verräter zu sehen, und Decentius wird sich auf deine Kosten verteidigen, sobald er am Hofe angelangt ist. Desgleichen Florentius. Wir haben bereits gesehen, wie sie sich verhalten.«
Julian überlegte. Am Tag vorher war ein Bote eingetroffen mit der Neuigkeit, dass Florentius von Vienne geflohen war und in seiner Hast Frau und Kinder zurückgelassen hatte. Julian hatte Befehl gegeben, sie und ihre Habe sicher in den Osten zu bringen; Constantius hätte sie sonst verhaften und hinrichten lassen.
»Ich möchte keinen Krieg mit ihm«, sagte er zu Eutherius. »Ich werde ihm schreiben und erklären, wie die Männer dazu getrieben wurden. Ich werde Truppen schicken, wie er es wünscht … allerdings nicht die Petulantes, die nicht gehen wollen, auch nicht die Heruler, die nicht hier sind. Aber wir schicken …« Er nannte die Einheiten, die er stattdessen hergeben wollte. »Ich werde Constantius bitten, einen neuen Präfekten zu ernennen, der seinem Wunsch entspricht. Doch davon abgesehen muss ich meinen Stab selbst wählen. Wir hätten uns viel Ärger ersparen können, hätte er mir das gleich zu Anfang gestattet. Soll er Befragungen anstellen; er wird sehen, dass ich die Wahrheit sage.«
»Und von wem wird er sie hören?«, fragte Eutherius. »Von Decentius und Florentius? Nein, gewiss nicht. Jemand muss zu ihm reisen und für dich sprechen.«
»Ich werde gehen. Ich war dabei und habe gesehen, wie es geschah.«
»Ich danke dir, Drusus«, sagte Julian lächelnd, »aber in dieses Schlangennest will ich dich nicht schicken. Dich möchte ich um etwas anderes bitten. Nein, es gibt nur einen Mann hier, auf den Constantius hören wird.«
Er blickte zu Eutherius, der von einer Schale voller Honigfeigen naschte. Seufzend stellte er sie ab.
»Ah! Wieder eine Reise im Winter. In diesem Fall, mein lieber Julian, schlage ich vor, dass Pentadius mich begleitet.«
»Pentadius? Aber warum? Er ist einer von Florentius’ Speichelleckern.«
»Deshalb wird Constantius ihm glauben.«
Pentadius hatte sich entschieden zu bleiben, obwohl er mit Decentius hätte flüchten können. Mittlerweile schien er zu bereuen, dass er den Notar unterstützt hatte, der lediglich die eigene Haut retten wollte und ihn im Stich gelassen hatte. Pentadius wusste nun, dass er benutzt worden war.
Oribasius, der bislang still dabeigesessen hatte, sagte: »Ganz gleich, was geschieht, du darfst nicht kapitulieren. Das weißt du.«
Julian nickte. Sein Wein – in einem gallischen Tonbecher mit Weintraubenrelief – stand noch unberührt vor ihm.
»Constantius muss mir lassen, was ich habe«, sagte er schließlich. »Alles andere ist unmöglich.«
»Ja, aber wird er dazu bereit sein?«
»Er hat die Perser im Nacken«, sagte Eutherius. »Er könnte einlenken, falls er keinen anderen Ausweg sieht. Aber erst einmal wird er kämpfen wie eine Katze im Netz.«
»Und da ist noch das Problem mit Lupicinus. Zwei der besten Legionen sind unter seinem Befehl in Britannien. Constantius wird ihm befehlen, gegen uns zu ziehen.«
Er werde Lupicinus einen Brief senden und ihn nach Paris zurückrufen, sagte Julian. Für diese Aufgabe brauche er mich. Marcellus und ich sollten nach Britannien reisen und dem Heermeister den Brief überbringen. Da Marcellus zu Lupicinus’ Stab gehörte, würde kein Misstrauen aufkommen. »Ihr müsst tun, was ihr könnt, damit Constantius’ Befehl nicht zu ihm gelangt. Ich werde vertrauenswürdige Männer in sämtliche gallischen und spanischen Häfen schicken – wo immer ein Bote ein Schiff besteigen kann. Aber das genügt vielleicht nicht. Ihr müsst euer Möglichstes von der anderen Seite tun.«
Julian sagte, er werde mich in den Rang eines Comes erheben, damit ich ausreichend Autorität besäße und nicht behindert werde. »Und sprich in London mit Alypius. Er ist ein Freund. Man kann ihm vertrauen.«
Eine Zeit lang besprachen wir die Einzelheiten. Bevor wir uns dann verabschiedeten, wandte er sich mir noch einmal zu. »Und nun, Drusus, gibt es noch eine Ungerechtigkeit, die ich seit Langem wiedergutmachen will.«
Er stand auf und nahm einen versiegelten Brief von einem Tischchen. Dabei fiel das Licht vom Lampenständer auf sein Gesicht, und ich sah, dass er errötete.
»Diese Urkunde spricht deinen Vater von allen Verbrechen frei und gibt dir den Familienbesitz zurück.«
Ich nahm das gefaltete Pergament entgegen und schaute auf das Siegel. Aber vor meinem geistigen Auge sah ich meinen Vater, wie er an dem Tag, an dem er mich weggeschickt hatte, vor dem Fenster seines sonnigen Arbeitszimmers stand. Julian hatte es wohl die ganze Zeit gewusst, aber nicht die Macht gehabt, zu handeln.
Ich blickte auf, um ihm zu danken, doch meine Kehle war wie zugeschnürt, und ich brachte kein Wort heraus.
»Sag mir, Drusus, glaubst du, dass die Götter im Traum zu uns sprechen, wie oft behauptet wird?«
Ich schluckte und dachte nach.
»Ja«, antwortete ich schließlich, »aber man braucht Verstand, um zu begreifen, was sie uns sagen wollen. Wir sind kein bloßer Spielball der Götter.«
Julian nickte lächelnd.
»Eine gute Antwort. Nur ein wohlgeordneter Geist sieht richtig. In der vergangenen Nacht träumte ich von einem großen Baum und seinen Wurzeln, in dessen Schatten ein Schössling wuchs. Der hohe Baum war halb umgestürzt, die Wurzeln aus der Erde gerissen. Als ich mich ihm näherte, um ihn zu betrachten, tippte Hermes mir auf die Schulter und sagte: Sieh her und fasse Mut; der Schössling bleibt im Erdreich; er wird erstarken, und der Baum wird eingehen.«
Er lachte verlegen.
»Und was soll das bedeuten?«, fragte ich.
Читать дальше