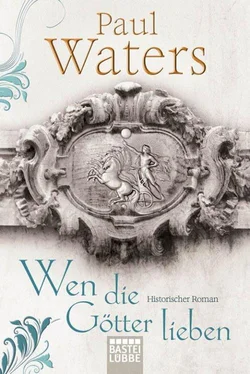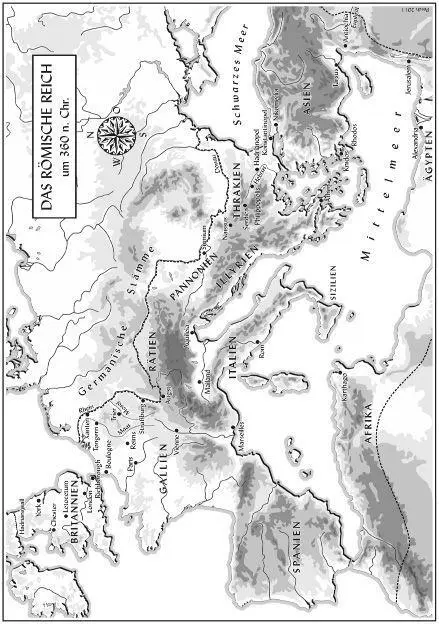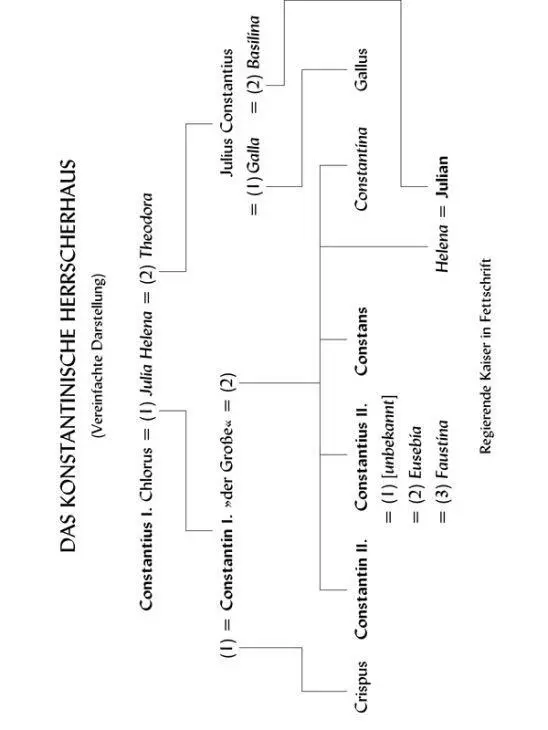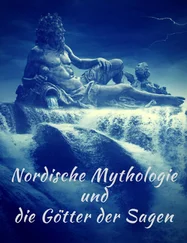Für K. W.
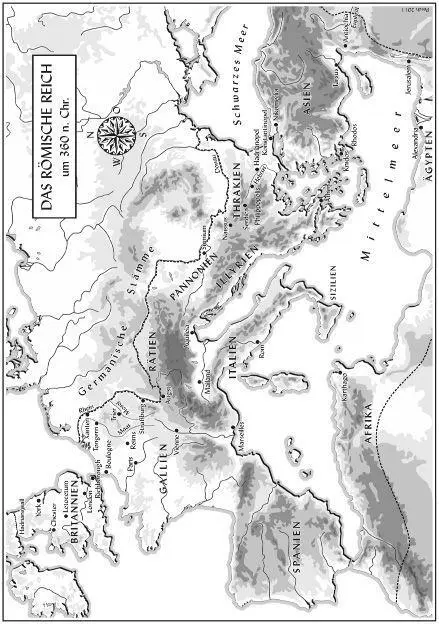
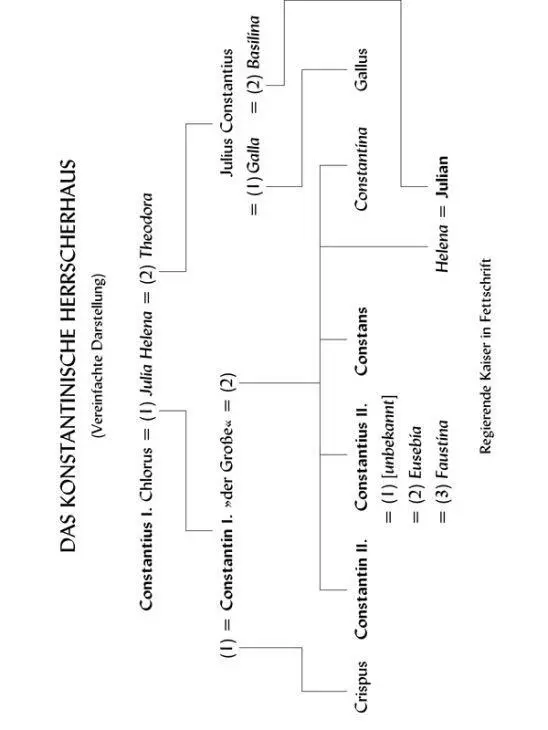
Des Menschen Streben sollte mehr sein, als er greifen kann. Wozu wär’ sonst der Himmel da?
Robert Browning, Andrea del Sarto
Immer wird es Menschen geben, die sich gegen einen Staat erheben, der die Menschlichkeit zerstört oder in dem es keine Möglichkeit mehr gibt, edel zu sein und große Taten zu vollbringen.
Leo Strauss, Noch einmal Xenophons »Hieron«

Das Feuer war endlich heruntergebrannt. Marcellus, der unerschrocken zugeschaut hatte, wandte sich ab und wischte sich über die Stirn. Aufatmend hob er den Kopf und entfernte sich von der Seite seiner Mutter, von den feierlich versammelten Sklaven und Knechten, von Tyronius, dem Gutsverwalter, und von dem treuen greisen Clemens, der seinen Herrn nun doch überlebt hatte. Kurz blieb er am Steinaltar stehen und warf eine Handvoll Weihrauch in den bronzenen Feuerkorb. Es zischte und fauchte. Blaue Rauchschwaden stiegen in die kühle britannische Luft und wogten über dem alten Heiligtum mit seinem Säuleneingang und dem schrägen Dach; dann trieb der Rauch davon und zerfaserte zwischen den nahen Pappeln.
Das jüngste der Sklavenmädchen wischte sich die Tränen ab. Marcellus blickte auf, bedachte das Mädchen mit einem knappen Lächeln und drehte sich um, wobei mich ein Blick aus seinen grauen Augen streifte. Ich hatte kaum gewagt, ihn anzuschauen, solange das Feuer toste und den Leichnam seines Großvaters verzehrte. Marcellus’ Gesicht war von der Hitze gerötet, und der Schmerz, der sich in feinen Linien um den Mund zeigte, machte ihn auf seltsame Weise schön.
Ich war ergriffen: Um der anderen willen und seinem Stolz zuliebe hielt Marcellus seine Trauer zurück.
Als wir allein gewesen waren, hatte er gesagt, Weinen sei unangemessen. Aquinus habe ein ehrbares, verdienstvolles Leben geführt. Er habe bewiesen, dass es auf der Welt einen Platz für das Gute gibt; Tränen und Wehklagen hätte er nicht gewollt. In der Tat hatte Aquinus sich der Tyrannei entgegengestellt, hatte die Provinz Britannien gerettet und war in hohem Alter friedlich in seinem Haus gestorben.
Halte niemanden für glücklich, bevor er tot ist und die höhnende Hand des Schicksals ihn nicht mehr treffen kann, hatte Aquinus einmal gesagt.
Ich ging einen Schritt und nickte Marcellus zu. Er nahm es mit leichtem Stirnrunzeln auf, als wollte er sagen: »Jetzt ist es so weit, Drusus. Von nun an müssen wir beide unseren Weg allein finden, so gut wir es vermögen.« Dann wandte er sich wieder der Zeremonie zu, ging zum Einäscherungsplatz zurück, ließ sich auf ein Knie nieder und sammelte die mit Wein heruntergekühlte Asche in einem Alabastergefäß, um es hernach zu denen seiner Ahnen in die Gruft zu stellen.
Als das Gefäß gefüllt war, sagte seine Mutter, die bislang still geblieben war, mit kalter Stimme: »Und damit endet dieses Geschlecht.«
Marcellus stockte. Mein Rücken verspannte sich. Es war der alte Streit zwischen ihnen, und ich war die Ursache.
Für einen kurzen Moment blickte Marcellus auf die Asche in seinen hohlen Händen. Ich sah, wie sein Gesicht hart wurde wie das eines Soldaten in der Schlacht. »Nein, Mutter«, widersprach er ruhig, »es gibt noch mich.«
Ohne aufzusehen, wartete er auf eine Erwiderung. Aber sie sagte nichts mehr, und so beendete Marcellus sein Tun und setzte schließlich den Deckel auf das Gefäß. Dann erhob er sich, nahm von Tyronius das dargebotene Tuch entgegen und wischte sich den Aschestaub von den Fingern. Seine Mutter, die während der Zeremonie starr und kalt geblieben war wie das Girlandenrelief an der Urne, blickte am Altar vorbei in die Ferne, als hätten ihre Worte nicht ins Herz getroffen.
Ich betrachtete sie über den heruntergebrannten Scheiterhaufen hinweg und fühlte Zorn in mir aufwallen. Marcellus hatte diesen Tag angemessen und ehrenvoll begehen wollen, als letzte Gabe an seinen Großvater, doch seine Mutter wollte den Streit nicht ruhen lassen, nicht einmal hier. Ich war der Feind, weil ihr Sohn – der Mann, den ich liebte – ihr versagte, was ihr Herz ersehnte, da er keine Frau ihrer Wahl heimführte und kein Kind zeugte, das für den Fortbestand der Familie sorgen würde. Sogar Aquinus hatte sie zuletzt auf seine sanfte, heitere Art gescholten: Sie übertreibe, hatte er gesagt, und solle auf die Götter und den Lauf der Zeit vertrauen. Doch den Göttern traute sie nicht, und die Zeit hatte ihr früh den Gemahl entrissen. So hatte sie versucht, die Welt nach ihren Wünschen einzurichten, doch die Welt hatte sich widersetzt.
Ich blickte auf das halb verbrannte Wacholderholz, das zu meinen Füßen schwelte. Wer bin ich, dass ich ihr Vorwürfe machen könnte?, fragte ich mich. Schließlich besaß ich, was ich wollte, wohingegen sie durch ihren Schmerz spröde und unnahbar geworden war. Mir hatte ein freundlicher Gott Marcellus beschert, der mein Leben reich machte und mein Herz entflammte. Wen hatte sie, um ihn dem Lauf der Jahreszeiten und dem unerbittlichen Verrinnen der Zeit entgegenzustellen? Ich wusste, dass sie mich verabscheute, und wünschte, es wäre nicht so. Aber hassen konnte ich sie nicht; dafür hatte ich selbst zu viel Trauer und Einsamkeit erlebt.
Ich seufzte und beobachtete, wie mein Atem sich mit der kalten Luft vermischte. Mit dem Einsetzen der Abenddämmerung begann sich alles um uns her mit Reif zu überziehen. Jenseits der Pappeln zog die bleiche Sonnenscheibe den Wipfeln des Waldes entgegen, und der Abendstern stand weiß funkelnd am Himmel.
Ich wandte mich Marcellus zu, der die Altarflamme mit Wein aus einem Silberkrug löschte. Auf der anderen Seite der schwelenden Holzreste, im Gegenlicht, beobachtete ihn seine Mutter unter ihrem Schleier hervor. Plötzlich hob sie den Kopf. Zuerst glaubte ich, sie sähe mich an, weil sie meine Gedanken erraten hatte. Doch sie blickte an mir vorbei übers Land. Dann sagte sie mit ihrer glasklaren Stimme: »Wer sind diese Leute?«
Alle drehten sich um. In dem langen Schatten der Anhöhe kamen Reiter hintereinander den Weg herunter.
»Kommen sie etwa deinetwegen? Ausgerechnet heute, wo du dich um deine Familie zu kümmern hast?«
»Nein, Mutter, natürlich nicht«, antwortete Marcellus. Er reichte den Krug an Tyronius und verließ den Lichtkreis der Fackeln. Ich trat neben ihn. Unwillkürlich, mit der Gewohnheit des Soldaten, griff ich zur Hüfte, wo gewöhnlich mein Dolch hing. Doch ich war für Aquinus’ Begräbnis gekleidet, nicht für den Kampf. Mein Dolch lag in seiner geflochtenen Lederscheide auf dem Tisch an meinem Bett.
Leise, nur für meine Ohren bestimmt, sagte Marcellus: »Schau, sie sitzen im Sattel wie Soldaten, nur dieser schäbig aussehende Bursche nicht, der Zweite von vorn, der in dem braunen Mantel.«
»Wenn es Soldaten sind, kenne ich sie nicht. Warum sind sie nicht in Uniform? Und wieso kommen sie von Westen über die Felder und nicht von der Straße?«
Marcellus spähte zu den Reitern hinüber. »Sie wollen nicht gesehen werden. Sie haben nicht damit gerechnet, uns hier draußen im Freien anzutreffen.«
»Wir sind nicht bewaffnet«, sagte ich.
Marcellus nickte. »Ich weiß.«
Er warf einen raschen Blick über die Schulter zu der hohen Mauer, die das Haus umschloss, und schätzte die Entfernung ab. Die Mauer war errichtet worden, um in Zeiten wie diesen – Zeiten der Barbarei – ein kleines Heer aufzuhalten. Hinter dieser Mauer wären wir sicher gewesen. Doch die Reiter galoppierten bereits ins Tal.
Читать дальше