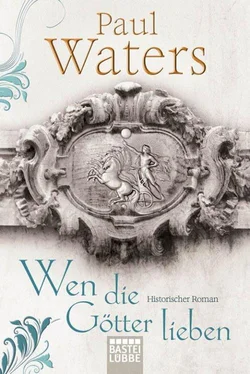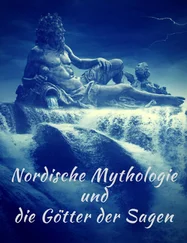Vielleicht war es nur das Gift der Intrigen, das durch die Zitadelle waberte wie Nebel, doch ich war mir sicher, eine private Andeutung herauszuhören. Mir fiel ein, wie Constantius während seines Krieges mit Magnentius die Barbaren aufgestachelt und zu Raubzügen auf römisches Gebiet geschickt hatte, ohne Rücksicht auf die Folgen, solange es nur seinen eigenen Zwecken nützte. Wollte Eutherius darauf anspielen? Wollte jemand Julian aus dem Weg räumen? Ich hatte keine sichere Antwort darauf. Wie auch immer, Eutherius wollte es nicht offen ansprechen.
Ich schob den Gedanken beiseite und sagte mir, ich sähe schon überall Verschwörer.
»Es ist gar keine Frage«, fuhr Eutherius fort und blickte Julian vielsagend an, »du musst in Gallien bleiben und einen anderen nach Britannien schicken.«
»Aber das ist doch eigentlich Aufgabe des Cäsars«, wandte Lupicinus ein. »Außerdem ist es sein eigener Wunsch, wie du gehört hast. Wozu also diese Diskussion?«
»Du hast im Osten gekämpft«, sagte Eutherius lächelnd, »ruhmreich, wie man hört. Nach den Persern werden ein paar keltische Raufbolde keine Gegner für dich sein.«
Wie immer Marcellus und ich über ihn dachten – Lupicinus war ein erfahrener, erfolgreicher Soldat. Erstaunlicherweise hatte er nun Einwände und verschanzte sich hinter logistischen Schwierigkeiten: Ob es nicht genüge, mehrere Einheiten zur Verstärkung zu schicken? Ob es nicht besser sei, wenn ein Mann seines Könnens in Gallien bliebe, falls die unberechenbaren Germanen wieder auf Raubzüge gingen? Ob es wirklich klug sei, die Überfahrt im Winter zu wagen, wo Stürme häufig und Truppentransporter leicht zu überwältigen seien?
Jeder – besonders Valentinian, dem es nicht gefallen hatte, ängstlich genannt zu werden – hörte verwundert zu, bis Julian ihn schließlich unterbrach: »Einer von uns muss gehen. Jede Verzögerung wird uns als Schwäche ausgelegt. Ist das nicht auch deine Ansicht?«
»Natürlich«, antwortete Lupicinus gereizt.
Julian nickte. Sein Blick schwenkte zu dem Bronzeofen mit seinen Girlandenreliefs und dann zu Eutherius, der sich die Hände daran wärmte und keine Miene verzog.
»Dann werde ich bleiben, wenn du es mir rätst, Eutherius. Wir dürfen nicht gefährden, was wir bisher erreicht haben. Wir werden genügend Männer hierbehalten, um unsere Flanken gegen die Germanen zu schützen.«
Einen Moment lang rieb er sich nachdenklich das Kinn. Dann drehte er sich zu Lupicinus um und sagte: »Nimm die Heruler und die Bataver. Sie sind gute, leidenschaftliche Kämpfer, und uns bleibt damit eine ausreichende Reserve, um notfalls die Rheingrenze zu verteidigen.«
So brach Lupicinus nach Britannien auf.
Bei Boulogne schiffte er sich ein, und bald darauf kam die Nachricht, er sei in London eingetroffen. Dann zog sich der Himmel zu, und wir warteten und munterten uns mit der Geschichte auf, die gerade die Runde machte, wonach Lupicinus in der Christenkirche gebetet und dann heimlich nach einem alten Priester geschickt und ihn gebeten habe, für eine sichere Überfahrt Weihrauch auf Neptuns Altar zu opfern.
Kurze Zeit später, Ende Januar, kam ein kaiserlicher Notar in die Zitadelle. Ein Hauptmann der Wache kündigte ihn an.
»Ein Notar?«, sagte Julian. »Kommt er von Florentius?« Wir hatten nichts mehr vom Präfekten gehört, seit er überstürzt nach Vienne abgereist war.
»Nein, Cäsar. Er sagt, er kommt vom Kaiser. Er heißt Decentius. Er fragte als Erstes nach dem Präfekten. Als ich ihm sagte, der Präfekt sei in Vienne, verlangte er Lupicinus zu sprechen.«
»… und der ist in Britannien.«
»Das sagte ich ihm ebenfalls. Darauf befahl er mir … äh, dich zu ihm zu rufen.«
»Zu rufen?«, wiederholte Julian und zog belustigt die Brauen hoch. »Er hat dir befohlen, mich zu ihm zu rufen?«
Der Hauptmann, ein junger Gallier, der gerade erst befördert worden war, blickte verlegen drein. »Ja, Cäsar. Das waren seine Worte.«
»Wenn das so ist«, sagte Julian, »sollten wir ihn lieber nicht warten lassen.«
Der Hauptmann war zu unruhig, um Julians Sarkasmus zu würdigen. Beim Hinausgehen drehte er sich noch einmal um.
»Was gibt’s?«, fragte Julian.
»Nur eines noch. Er wies mich an, gleich anschließend Sintula zu suchen und ihn ebenfalls zu ihm zu bringen.«
»Was kann er von Sintula wollen?«, überlegte Julian, nachdem der Hauptmann gegangen war.
Ich kannte Sintula. Er war ein ehrgeiziger Offizier der Palastwache, dessen Hauptsorge das eigene Vorankommen war. Es war allgemein bekannt, dass er zu Florentius’ Klientel gehörte. Offenbar hielt auch der Hauptmann es für sonderbar, dass Sintula an dem Gespräch teilnehmen sollte, denn politische Angelegenheiten gingen ihn nichts an.
Sintula jedoch vergeudete keine Zeit. Als wir im großen Audienzsaal eintrafen, wartete er bereits mit selbstzufriedener Miene wie ein Kind, das ein wichtiges Geheimnis hütet. Bei ihm war ein Mann mit schwarzem Haarschopf und einem kleinen, bösartigen Mund, der die schwarze Tracht der kaiserlichen Notare trug.
Als Julian den Saal betrat, erklärte der Notar in barschem Tonfall und mit lauter Stimme: »Ich hatte gehofft, den ehrenwerten Lupicinus anzutreffen. Doch wie es scheint, hast du ihn weggeschickt.«
»Lupicinus ist in Britannien«, begann Julian und wurde sogleich unterbrochen.
»Das ist mir bekannt.«
Julians Miene wurde hart. Er legte wenig Wert auf zeremonielles Auftreten, konnte aber sehr wohl zwischen Ungezwungenheit und Frechheit unterscheiden. Das Korps der Notare – Constantius’ persönliche Agenten – waren im gesamten Imperium verhasst, und das aus gutem Grund. Sie standen über dem Gesetz, jedenfalls glaubten sie das; sie waren hochfahrend und gefährlich; sie missbrauchten ihre Macht, die nicht klar umgrenzt war, und in den Augen des Kaisers konnten sie nichts verkehrt machen.
Ohne Julians Miene zu beachten, fuhr der Mann in demselben Tonfall fort: »Die Befehle, die ich bringe, waren für den Heermeister Lupicinus bestimmt. Im Falle seiner Abwesenheit war ich gehalten, mit dem Präfekten Florentius zu sprechen. Und nun stelle ich fest, dass er ebenfalls nicht da ist.«
»Er ist in Vienne.«
»Ja. Das ist misslich.«
»Du hast gebeten, mit mir zu sprechen«, sagte Julian kalt. »Nun, hier bin ich. Was willst du?«
Der Notar seufzte; dann schnippte er mit den Fingern und machte eine kleine fordernde Geste, worauf ein Diener mit einer Schriftrolle zu ihm trat. Darauf sah ich im flackernden Licht der Wandfackeln das große kaiserliche Siegel glänzen.
»Du kennst den Inhalt?«, fragte Julian.
»Allerdings«, antwortete der Notar. »Und ich bin hier, um Sorge zu tragen, dass die Anweisungen ausgeführt werden.«
Julian machte schmale Augen. »Und?«, sagte er langsam. »Was wünscht der Kaiser?«
»Du sollst Soldaten aus Gallien schicken, die der Kaiser für seinen Krieg mit den Persern benötigt, und zwar folgende Legionen: die Heruler, die Bataver und von den Hilfstruppen das Keltenregiment und die Petulantes, dazu dreihundert Mann aus jeder der übrigen Einheiten sowie eine Abteilung der Palastgarde.«
Als er schwieg, sagte Julian leise: »Ist dir klar, dass du mehr als die Hälfte meines Heeres verlangst?«
Der Notar lächelte schmal. »Ich bin kein Mann des Militärs, Cäsar. Ich bin hier, um die Befehle des Kaisers auszuführen. Außerdem wurde ich angewiesen, dir zu sagen, dass du dich nicht einmischen sollst. Die Befehle sind für die Bevollmächtigten des Kaisers in Gallien bestimmt, den Heermeister Lupicinus und den Präfekten Florentius. Ich teile dir diese Befehle nur aufgrund der Abwesenheit der beiden Männer mit, aus Höflichkeit. Dieser Tribun«, er deutete mit einem Nicken auf Sintula, »soll mit der Auswahl der Soldaten betraut werden, damit tatsächlich die besten genommen werden. Dann soll er die Männer der Palastgarde nach Osten führen.«
Читать дальше