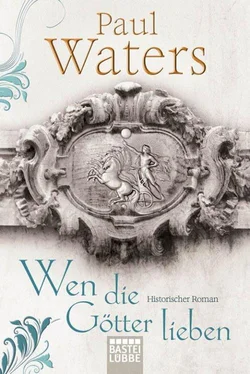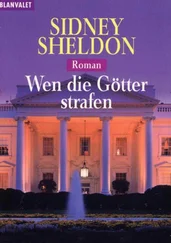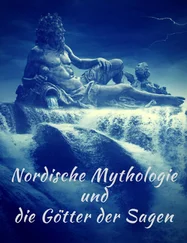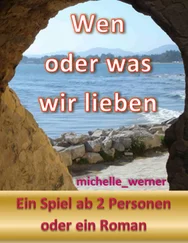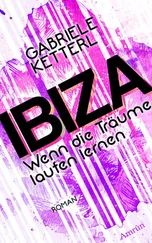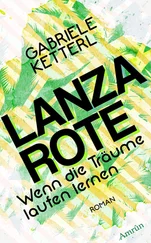Er machte sich nicht die Mühe, Julian persönlich davon zu unterrichten, sondern schickte einen Untergebenen. Vermutlich hätte er nicht einmal das getan, wäre nicht die Unterschrift des Cäsars nötig gewesen, da es eine außerordentliche Steuer war.
Julian sprach mit dem Beamten im Audienzsaal der Zitadelle unter dem hallenden Tonnengewölbe mit seinen gedrungenen Säulen und den verblassten Wandteppichen. Gewöhnlich zog er sein Arbeitszimmer vor, doch an diesem Tag entschied er sich mit Absicht für den kalten, schlecht beleuchteten Saal, da er wusste, dass hinter Säulen und Wandteppichen Lauscher standen, die nur darauf warteten, ihren Zahlmeistern jedes Wort berichten zu können.
»Bitte den Präfekten, das zu überdenken«, sagte Julian behutsam – und laut. »Die Bürger der Provinz können sich kaum noch selbst ernähren. Ich habe die letzten drei Jahre damit verbracht, die Grenzen zu sichern und zu befestigen. Gib dem Präfekten zu bedenken, dass ein kluger Bauer nicht erntet, bevor das Korn reif ist. Sag ihm, er möge persönlich zu mir kommen, dann sprechen wir vertraulich darüber.«
Aber Florentius kam nicht. Eines Morgens, ein paar Tage später, legte er den Befehl zur Unterschrift vor, diesmal persönlich, aber in Begleitung einer Schar seiner eifrigen Beamten. Es war ein sehr förmliches Dokument, das von Schreibern vorbereitet und für die Archivakten bestimmt war.
»Was ist das?«, fragte Julian.
In seiner gewohnt hochfahrenden Art antwortete Florentius, es sei die Vollmacht zur Steuererhebung, wie dem Cäsar bereits mitgeteilt worden sei.
Bis zu diesem Augenblick hatte Julian den Präfekten stets mit kühler Höflichkeit behandelt. Doch nun war seine Geduld am Ende. Mit einem zornigen Aufschrei riss er dem Beamten das Dokument aus der Hand und warf es auf den Boden.
»Hältst du mich für einen Narren?«, schrie er. »Die Bürger klagen dich der Erpressung im Amt an, und du antwortest darauf mit neuen Abgaben. Sie können sie nicht zahlen, sag ich dir!«
Florentius’ Miene wurde steinern. Gefährliche rote Flecke bildeten sich auf seinen blassen Wangen. Bei all seinen Intrigen und Nadelstichen kam dieser Ausbruch überraschend für ihn. Auf solche Weise angesprochen zu werden, noch dazu vor den eigenen Beamten, war ein Skandal, der über seinen mittelmäßigen Verstand ging.
»Die Erhebung«, erwiderte er leise und mit frostiger Stimme, »ist eine Angelegenheit für sich. Und ich darf den Cäsar daran erinnern, dass die Klage, die man gegen mich erhoben hatte, eine Schikane war und aus Mangel an Beweisen fallen gelassen wurde.«
»Mangel an Beweisen?«, rief Julian. »Ja, allerdings! Erst als die Kläger, nachdem sie eine detaillierte Klage gegen dich vorbereitet hatten, verwundert feststellten, dass sie sich genau in dem Beweis irrten, den sie selbst ans Licht gebracht hatten. Und zwar nachdem sie alle – plötzlich und auf unerklärliche Weise – reich geworden waren. Sie haben sich zum Gespött gemacht, und du hältst mich offenbar für genauso dumm wie sie!«
Die Beamten, die hinter dem Präfekten standen, starrten entsetzt zu Boden. Florentius erwiderte mit erhobener, schwankender Stimme: »Du hast kein Recht, meine Autorität in Frage zu stellen. Der Kaiser hat mich ermächtigt, die finanziellen Angelegenheiten Galliens nach meinem Ermessen zu führen, aber du mischst dich ständig ein. Das werde ich nicht dulden.«
»Und hat der Kaiser dich auch ermächtigt, Freistellungen zu verkaufen?«, verlangte Julian zu wissen. Dies war ein langjähriger Machtmissbrauch: Jene Steuereintreiber, die Landbesitzer und reiche Dekurionen waren, sammelten die Steuern bei der Landbevölkerung ein; danach, im Besitz der Gelder also, begehrten sie Steuernachlässe mit der Begründung, die Steuern könnten nicht gezahlt werden, und behielten den Differenzbetrag für sich.
Florentius starrte ihn wütend an und wusste erst einmal nicht weiter. Ihm war wohl nicht bekannt gewesen, dass Julian von der Sache wusste.
»Nein, natürlich nicht«, fuhr dieser fort. »Ich werde diese Abgabe nicht akzeptieren. Ich werde nicht unterschreiben. Das habe ich oft genug gesagt. Haben deine Spione dir das nicht hinterbracht? Dabei hast du wahrhaftig genug davon!«
Mit einem eisigen Lächeln erwiderte Florentius: »Wenn das so ist, wirst du dem Kaiser vielleicht erklären wollen, wie du das Minus bei den Geldmitteln ausgleichen wirst.«
Darauf folgte erst einmal Schweigen. Julian senkte den Blick auf den rot-gelben Marmorboden und die verstreut liegenden Blätter des Steuerdokuments. Auf Florentius’ Gesicht erschien ein Ausdruck der Befriedigung, obwohl er hätte ahnen können, wie Julian auf eine solche Herausforderung antworten würde. Die Beamten sahen auf; ihre Neugier siegte über die Angst.
»Ich werde mehr tun als das, Präfekt«, sagte Julian. »Ich werde die Zahlungen selbst betreiben. Ich werde die Mittel ohne Rückgriff auf deine Erhebung erbringen. Wenn mir das nicht gelingt, werde ich die Ermächtigung unterschreiben.«
Florentius schaute seinen Sekretär an – den Mann, der Marcellus und mich seinerzeit vor die Tür gesetzt hatte. Dann wandte er sich höhnisch lächelnd wieder Julian zu.
»Du willst die Mittel erbringen? Also gut, warten wir’s ab. Aber wenn es fehlschlägt, wirst du dich – gib dich keinen Zweifeln hin – vor dem Kaiser verantworten.«
»Und wenn es mir gelingt, was wirst du Constantius dann sagen?«
Florentius schnaubte verächtlich. »Du wirst gewiss Verständnis haben, Cäsar, wenn ich mich an müßiger Plauderei nicht beteilige. Und du hast sicher viel zu tun.« Damit machte er auf dem Absatz kehrt und ging. Seine Beamten eilten ihm hinterher wie Entenküken der Mutter.
Als sie fort waren, drehte Julian sich zu mir um. Wahrscheinlich war ich genauso blass wie die anderen.
»Jetzt sollte ich am besten dafür sorgen, dass ich das Versprechen wahr machen kann.«
Am nächsten Tag schickte Florentius eine Schar von Beamten zu Julian, die ihm dicke Wälzer voller Zahlenreihen zur Durchsicht brachten. Julian warf einen Blick darauf, begriff, was der Präfekt damit bezweckte, und schickte die Beamten mitsamt den Büchern fort. Während der Nacht hatte er einige Überlegungen angestellt. Jetzt kündigte er an, keine zusätzlichen Steuern zu erheben; stattdessen werde er die bestehenden Steuerforderungen halbieren.
Als Florentius’ oberster Buchhalter davon erfuhr, kam er über den Hof gerauscht, aschfahl im Gesicht und empört schnalzend. Was der Cäsar sich dabei gedacht habe? Er werde eine Katastrophe auf ihn und alle anderen herabbeschwören. Noch aber sei es nicht zu spät, die Ankündigung zurückzunehmen. Man werde eine Möglichkeit finden, sie als Irrtum hinzustellen, als Versehen eines Schreibers, eines kleinen Buchhalters.
»Ich möchte sie nicht zurücknehmen«, beschied Julian. »Wenn die Steuer nicht so belastend ist, werden mehr Leute sie zahlen.«
Der Oberbuchhalter ging kopfschüttelnd und schnalzend davon.
Aber Julian war damit noch nicht fertig. Als Nächstes verkündete er ein Ende der Steuernachlässe. Die reichen Grundbesitzer waren außer sich. Sie schickten Abordnungen nach Paris und behaupteten, kein Geld zu haben. Julian betrachtete ihre schön gearbeiteten, glänzenden Wagen, ihre reinrassigen, übertrieben herausgeputzten Pferde und ihre teuren italienischen Kleider und schickte sie weg. Er sagte, er höre lieber auf die Kleinbauern, die ihre Ware auf dem Markt verkauften, und auf die städtischen Handwerker, die Bäcker, Korbmacher, Töpfer, Tuchwalker und Färber, die kein großes Vermögen besaßen und sich keinen Einfluss kaufen könnten, die ihre Steuer aber stets sofort bezahlten – Männer also, die Florentius niemals in seine Überlegungen einbeziehen, geschweige denn mit ihnen sprechen würde. Julian aber kannte sie. Es waren die Söhne jener Männer, die ihm im Heer dienten; es waren ihre Familien, die die Barbaren als Erstes überfallen würden, wenn man sie ins Land ließe.
Читать дальше