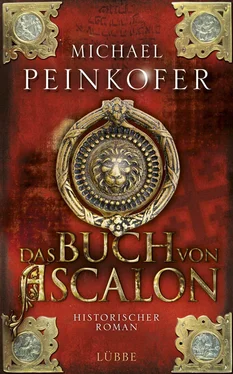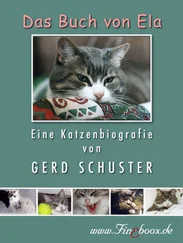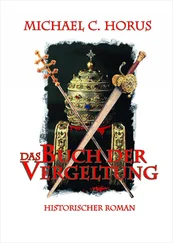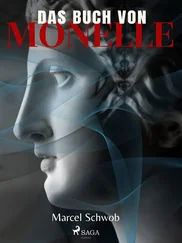Conn nickte nachdenklich. Im Nachhinein erklärte das, weshalb er im Lager so lange vergeblich nach Baldric und den Seinen gesucht hatte. Und auch, wie Baldric zu seinem Ruf als geübter Späher gekommen war.
»Als wir dich schließlich fanden«, fuhr Bertrand fort, »hat Baldric seinem Schöpfer auf Knien dafür gedankt. Als er dich an Sohnes statt annahm, war das nicht nur eine Geste. Der alte Dickschädel liebt dich wie einen leiblichen Sohn, Conn. Das solltest du nie vergessen.«
Conn atmete tief durch. »Das werde ich nicht«, versprach er und wollte gehen.
»Wohin des Wegs?«
»Mein Pferd satteln. Baron de Reins Truppen versammeln sich bereits.«
»Ich komme mit dir«, erklärte der Normanne und erhob sich.
»Das musst du nicht.«
»Doch«, widersprach Bertrand grinsend. »Alles andere würde mir der gute Baldric niemals verzeihen.«
»Du hast was getan?«
Entsetzt starrte Chaya auf ihren Cousin, der gesenkten Hauptes vor ihr stand, den Blick zu Boden geschlagen wie ein Kind, das gescholten wurde.
»Ich bin im Lager der Christen gewesen«, wiederholte er leise. »Ich wollte das Buch wiederbeschaffen. Und ich wollte deine Ehre wiederherstellen.«
»Meine Ehre?« Chaya, die auf einer der steinernen Bänke gesessen hatte, die die Säulenhalle des Innenhofs säumten, sprang erschüttert auf. »Was redest du da? Was hat das zu bedeuten?«
Caleb schaute auf. »Du weißt, was es bedeutet«, sagte er nur.
»Du … du wolltest Conwulfs Tod?«, hauchte Chaya.
»Sorge dich nicht«, erwiderte Caleb mit bitterem Spott. »Der Christ ist noch am Leben.«
»Du bist ihm also begegnet?« Chaya ertappte sich dabei, dass sie spontane Freude verspürte, obschon das Gegenteil der Fall hätte sein müssen. Kaum ein Tag war in den letzten Wochen vergangen, da sie nicht im Zorn an den jungen Angelsachsen gedacht hatte, der sie so schändlich hintergangen und ihr das Buch von Ascalon gestohlen hatte. Ihr Onkel sprach kaum noch mit ihr, und wäre es nicht um seines Bruders willen, hätte er sie wohl längst aus dem Haus gejagt.
»Das bin ich«, bestätigte Caleb nickend.
»Und? Was hat er gesagt?«
»Was interessiert dich das? Ich denke, du hasst ihn?«
»Was hat er gesagt?«, wiederholte Chaya.
Caleb schnaubte verächtlich. »Dass er das Buch nicht gestohlen hat – was hätte er auch sonst sagen sollen?«
»Ist das alles?«
»Das ist alles. Und er hat mein Leben geschont, als er es hätte nehmen können. Die Klinge lag bereits an meiner Kehle.«
»Ihr habt gekämpft?«
Caleb nickte. »Nicht viel hätte gefehlt, und mein Dolch hätte den Christenhund ereilt.«
»Und dann?«, fragte Chaya entrüstet. »Glaubst du, sein Tod hätte irgendetwas bewirkt? Dass er das Buch von Ascalon zurückgebracht hätte? Warum nur dürstet ihr Männer immer nach Blut?«
»Weil nur Blut die Schande reinwaschen kann, die über dich gekommen ist, Cousine.«
»Die Schande?« Chaya blickte an sich herab. Noch war die Wölbung ihres Bauchs nur klein und unter dem Stoff ihres Kleides nicht zu sehen, aber schon bald würde sich dies ändern. »So siehst du es also? Dann lass dir sagen, Caleb Ben Ezra, dass diese Schande nicht über mich gekommen ist wie ein Unwetter oder ein Schicksalsschlag. Ich habe mich Conwulf freiwillig hingegeben, und deshalb trifft mich mindestens ebenso große Schuld wie ihn.«
Caleb verzog missbilligend das Gesicht, so als ob er derlei Einwände gar nicht hören wollte. »Du verteidigst ihn? Trotz allem, was geschehen ist?«
»Was wir getan haben, war falsch, das weiß ich jetzt. Auch wenn ich es gerne ungeschehen machen würde, ich kann es nun einmal nicht.«
»Und das Buch?«
Chaya zuckte mit den Schultern. »Wenn du jemandem die Schuld am Verschwinden des Buches geben willst, dann kannst du ebenso gut mich beschuldigen. Ich habe es von meinem Vater bekommen, und ich habe ihm geschworen, es unter Einsatz meines Lebens zu hüten. Es war meine Aufgabe, meine Pflicht – und ich habe versagt, Caleb. Ich ganz allein!«
»Aber doch nur, weil dieser elende Bastard dich getäuscht und hintergangen hat!«
»Das wissen wir nicht mit Bestimmtheit. Du hast gehört, dass Conn seine Unschuld beteuert …«
»Und? Du schenkst den Lügen des Christen doch hoffentlich keinen Glauben mehr? Hast du mir nicht selbst erzählt, dass er in London ein Dieb gewesen ist? Einmal ein Dieb, immer ein Dieb!«
»Was ich glaube, ist nicht von Bedeutung. Ich weiß nur, dass Conn dein Leben geschont hat, was er nicht hätte tun müssen, denn du hattest ihn angegriffen. Es wäre sein gutes Recht gewesen, sich mit gleichen Mitteln zur Wehr zu setzen. Aber er hat dich am Leben gelassen, und dafür bin ich ihm dankbar. Was hast du dir nur dabei gedacht, eine solche Dummheit zu begehen?«
»Ich wollte dir damit helfen«, erwiderte er ein wenig unbeholfen.
»Mein guter Caleb, du hilfst mir nicht, indem du dich umbringen lässt. Oder indem du den Vater des Kindes tötest, das ich in mir trage. Du bist der Einzige, der von meinem Zustand weiß, und ich habe es dir nicht erzählt, damit du losziehst und meine Ehre mit Blut reinwäschst, sondern weil du der Einzige bist, der mir geblieben ist und mit dem ich sprechen kann.«
»Ist das wahr?«, fragte Caleb hoffnungsvoll.
»Aber ja«, versicherte sie lächelnd. »Du neigst zum Jähzorn und bisweilen auch zur Aufschneiderei. Aber du bist auch der einzige Freund, den ich noch habe.«
Calebs Hoffnung zerplatzte wie eine Seifenblase.
»Natürlich«, murmelte er säuerlich. »Nur ein Freund.«
23.
Al-Bira, nordwestlich von Antiochia
31. Dezember 1097

Das Erwachen war böse.
Die Kämpfer der Streitmacht, die unter der Führung des Normannen Bohemund und des flämischen Grafen Robert ausgezogen war, um im weiten Hinterland Antiochias Vorräte für das hungernde Heer zu beschaffen, ruhten noch, als die Alarmrufe der Wachen sie aus dem Schlaf rissen. Hörnerklang scholl durch das Lager, heisere Befehle wurden gebrüllt.
Auch Conn fuhr in die Höhe.
Infolge der Kälte und des anstrengenden Marsches, den das Heer am Vortag bewältigt hatte, war sein Schlaf tief und voller Träume gewesen. Chaya war darin vorgekommen, ebenso wie Baldric und Pater Berengar. Wenn Conn auch nicht zu sagen vermochte, worum es genau gegangen war, blieb beim Erwachen doch ein schales Gefühl. Zeit, darüber nachzudenken, hatte er allerdings nicht.
»Was ist los?«, fragte er Bertrand, der das Lager neben ihm besetzte und ebenfalls aus dem Schlaf geschreckt war.
»Weiß nicht.« Der Normanne schüttelte das lockige Haupt. »Vielleicht wieder eine von diesen Übungen, die Bohemund so liebt.«
Doch es war keine Übung.
Als die Männer aus dem Zelt traten, sahen sie sofort, was die Wachen so in Aufregung versetzte: Ringsum auf den Hügelgraten, die das Tal umgaben, waren feindliche Soldaten aufmarschiert, seldschukische Krieger, deren Silhouetten sich bedrohlich gegen den dämmernden Morgenhimmel abzeichneten. Conn schluckte, denn soweit er es beurteilen konnte, mussten es Tausende sein.
»Zu den Waffen! Zu den Waffen!«
Der Ruf erklang, und aus der Lethargie, die die Männer eben noch gefangen hielt, wurde lärmende Betriebsamkeit. Hals über Kopf stürzten sie zurück in die Zelte, legten in aller Hast ihr Rüstzeug an und griffen zu den Waffen – während oben auf den Hügeln die türkischen Bogenschützen die Sehnen zurückzogen und einen ersten Schwarm gefiederten Verderbens auf das Feldlager niedergehen ließen.
Ein unheimliches Rauschen erfüllte die Luft, als Tausende von Pfeilen in den grauen Himmel stiegen, ihre Spitzen senkten und schließlich mit vernichtender Wucht auf das Lager und seine Bewohner niedergingen. Mit furchtbarer Gewalt schlugen die Geschosse ein, durchdrangen die Bahnen der Zelte und die Planen der Wagen, die die bislang erbeuteten Vorräte trugen. Todesschreie vermischten sich mit heiser gebrüllten Befehlen, von einem Augenblick zum anderen brach Panik unter den Kreuzfahrern aus.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу