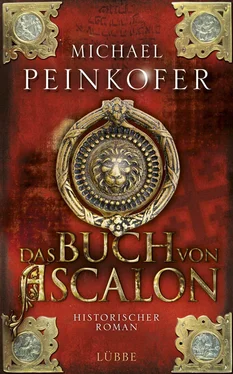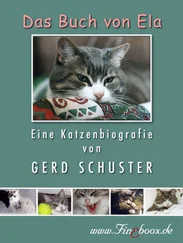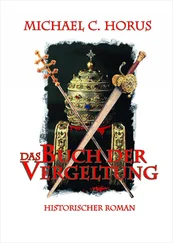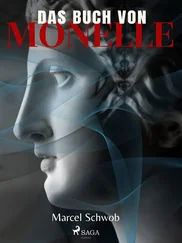»Wo ist Chaya? Ich muss zu ihr!«
Caleb schüttelte den Kopf. »Sie will dich nicht sehen.«
»Aber ich habe das Buch nicht an mich genommen«, versicherte Conn. »Und ich wusste auch nichts von … von ihrem Zustand.«
»Glaubst du, das mindert deine Schuld?«
Conn überlegte kurz. Dann ließ er Caleb los und stieß ihn von sich. Den Dolch rammte er kurzerhand vor ihm in den Boden.
»Was tust du?«, fragte der Jude verblüfft.
»Ich lasse dich frei«, erklärte Conn, während er sich wieder auf die Beine raffte.
»Obwohl ich dich töten wollte?« Caleb war wenig überzeugt.
»So ist es. Ich schenke dir das Leben – dafür möchte ich, dass du Chaya eine Nachricht von mir überbringst.«
»Sie wird mir nicht zuhören.«
»Sie wird. Sage ihr, dass ich den Verlust des Buches bedaure, aber dass mich daran keine Schuld trifft. Und richte ihr ebenfalls aus, dass ich …«
»Na was?«, hakte Caleb ungeduldig nach, als Conn zögerte.
Conn schüttelte den Kopf. Er wusste nicht, was er dem Boten noch mit auf den Weg geben sollte. Sollte er Chaya seine Liebe gestehen? Ihr seine Hilfe anbieten? Sie um Verzeihung bitten? Unsinn – schließlich war sie es, die sich davongeschlichen hatte und ihn nun offenbar eines Diebstahls verdächtigte, den er nicht begangen hatte. Der Gedanke allerdings, dass sie ein Kind von ihm erwartete, brachte ihn vor Sehnsucht fast um den Verstand. Egal, was gewesen war, er wollte bei ihr sein, wollte für sie sorgen, obschon er wusste, dass es unmöglich war. Sie lebten in unterschiedlichen Welten, auf den gegnerischen Seiten eines mörderischen Konflikts.
»Dass sie auf sich achten soll«, erwiderte er deshalb ausweichend. »Wirst du das für mich tun, Caleb?«
»Was ist, wenn ich mich weigere?«
»Ich werde dich dennoch ziehen lassen. Aber wenn du der bist, für den ich dich halte, wirst du Chaya meine Nachricht überbringen.«
»Und – mein Dolch?« Caleb schielte nach der Waffe, die im Boden steckte, nur zwei Armlängen von ihm entfernt.
»Nimm ihn, ich habe keine Verwendung dafür. Und jetzt geh.«
Mit einer Mischung aus Zweifel und Staunen schaute Chayas Cousin ihn an. Dann kroch er vorsichtig auf den Dolch zu, zog ihn heraus und nahm ihn an sich – und im nächsten Moment war er auch schon aufgesprungen und die dunkle Gasse hinab verschwunden.
Einige Augenblicke lang stand Conn unentschlossen da. Dabei merkte er, wie etwas warm und feucht seinen Hals hinabrann. Er tastete danach – es war Blut. Calebs unerwartete Attacke hatte seine Haut geritzt, doch Conns Überraschung war so groß gewesen, dass er erst jetzt davon Notiz nahm.
Er beschloss, zum Zelt zurückzukehren, um die Wunde zu versorgen. Unterwegs versuchte er, das Durcheinander in seinem Kopf halbwegs zu ordnen. Chaya bekam ein Kind von ihm! Noch immer war er nicht über diese Neuigkeit hinweg, auch wenn er sie nicht von Chaya selbst, sondern von ihrem rachsüchtigen Cousin erfahren hatte. Er spürte, dass es nun ein unsichtbares Band zwischen ihnen gab, ein Band, das zum Zerreißen gespannt war.
Conn konnte nur erahnen, was Chaya erwartete, wenn bekannt wurde, dass sie als unverheiratete Frau ein Kind erwartete, noch dazu von einem Christen, und er fühlte sich elend und schuldig deswegen. Aber warum verdächtigte sie ihn, das Erbe ihres Vaters gestohlen zu haben? War dies der Grund für ihre Ablehnung, für ihren überstürzten Aufbruch? Wie konnte er sie seiner Unschuld versichern?
»Conwulf! Um Himmels willen!«
Berengars entsetzter Ausruf riss ihn aus seinen Gedanken. Der Mönch ließ das Feuerholz fallen, das er gesammelt hatte, und kam auf ihn zu. »Was, im Namen des Allmächtigen, ist dir widerfahren?«, fragte er, auf den Schnitt an Conns Kehle deutend.
»Nichts weiter, Pater«, versicherte Conn, während Berengar die Wunde bereits näher inspizierte. »Ich habe nur …«
Er stutzte, als ihm plötzlich ein Gedanke kam. Ein hässlicher Gedanke, dessen er sich beinahe schämte. »Darf ich Euch etwas fragen?«, erkundigte er sich deshalb vorsichtig.
»Natürlich, Junge. Was möchtest du wissen?«
»In jener Nacht, bevor Chaya das Lager verließ …«
Berengar schnaubte. »Denkst du immer noch an sie?«
»… was habt Ihr da getan?«, brachte Conn seine Frage unbeirrt zu Ende. »Wollt Ihr mir das sagen?«
»Was ich in jener Nacht getan habe?« Der Benediktiner schaute ihn verständnislos an. »Aber das weißt du doch – ich hielt Wache. Warum willst du das wissen?«
»Nur so, ich …« Conn brach kopfschüttelnd ab und kam sich vor wie ein ausgemachter Narr. »Bitte verzeiht, Pater, ich weiß nicht, ob …«
Er verstummte, als ein Fremder zu ihnen trat, der Kleidung nach ein Normanne. »Ist er das?«, fragte der junge Mann nur.
»Das ist er«, bestätigte Berengar, auf Conn deutend.
Verblüfft schaute Conn von einem zum anderen. »Was soll das heißen? Wer seid Ihr?«
»Hast du es denn nicht mitbekommen?«, fragte Berengar seinerseits. »Im ganzen Lager wird nach dir gesucht.«
»N-nach mir?« Unwillkürlich wich Conn einen Schritt zurück.
»Ich komme von Baron Renald de Rein«, erklärte der Bote schlicht. »Mein Herr wünscht dich zu sprechen. Jetzt gleich.«
21.

Conn kam es vor, als würde er auf glühenden Kohlen stehen.
In Renald de Reins Zelt auf das Eintreffen des Barons zu warten, kam einer Folter gleich. Unendlich viele Dinge gingen Conn dabei durch den Kopf, Befürchtungen und Ängste, Fragen, auf die er keine Antwort wusste.
Wieso, in aller Welt, verlangte de Rein ihn zu sprechen? Wie konnte der Baron überhaupt Kenntnis von ihm haben? Hatten die de Reins womöglich herausgefunden, dass er sie in jener Nacht in London belauscht hatte? Hatten sie Kenntnis erlangt von seinen Racheplänen, von dem Schwur, den er geleistet hatte? Und wenn es so war, woher hatten sie ihr Wissen?
Es gab nur eine Handvoll Menschen, denen sich Conn anvertraut hatte, und er schämte sich fast dafür, dass er in diesem Moment, da er auf seinen Richter wartete, für keinen von ihnen die Hand ins Feuer gelegt hätte. Nicht für Bertrand, der die de Reins von früher zu kennen schien, nicht für Berengar, der ihn an de Reins Boten verraten hatte, und auch nicht für Chaya, die sich heimlich davongeschlichen hatte und ihn des Diebstahls bezichtigte.
Für einen kurzen Moment hatte er die Flucht erwogen, aber dann war ihm klar geworden, dass diese unerwartete Entwicklung der Dinge ihn genau dorthin gebracht hatte, wohin er die ganze Zeit über gewollt hatte – in die Höhle des Löwen. Vielleicht, dachte er in seiner Verzweiflung, konnte er die Gelegenheit nutzen, um nahe genug an Guillaume de Rein heranzukommen und das zu tun, was er sich geschworen hatte. Zweifellos würde es das Letzte sein, was er tat, aber wenigstens würde er Nias Mörder mit sich nehmen …
Unruhig trat Conn von einem Bein auf das andere, während er sich in dem geräumigen Zelt umblickte. Die de Reins gehörten zu jenen Privilegierten, denen es auch in der Fremde an nichts gebrach. Mit Teppichen und Schranktruhen, dazu einem langen Tisch, auf dem Zinnbecher und eine mit Wein gefüllte Karaffe standen, war die behelfsmäßige Bleibe besser eingerichtet als jedes feste Dach, das Conn je über dem Kopf gehabt hatte. Bei dem Gedanken, dass ein Verbrecher vom Schlage Guillaume de Reins in solchen Annehmlichkeiten schwelgen durfte, während so viele rechtschaffene Männer ihr Haupt auf den nackten Boden betteten, verspürte Conn Wut.
»Da bist du ja«, sagte plötzlich jemand – verblüffenderweise kam Conn die Stimme bekannt vor. »Es war alles andere als einfach, dich in diesem Durcheinander zu finden, das sich Heerlager nennt.«
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу