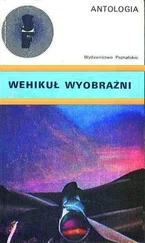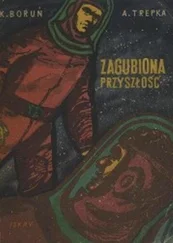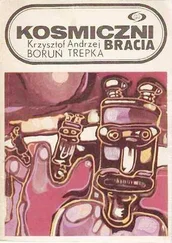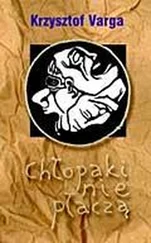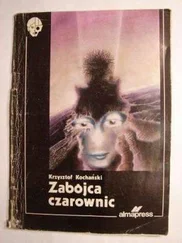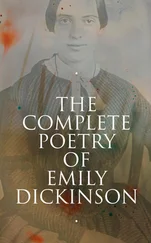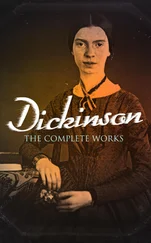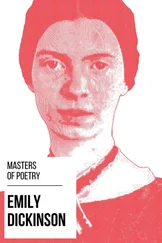So fielen etwa während einer Familiensitzung ein paar bedeutende Worte, die beispielhaft zeigten, welche Rolle Metaphern im Familiennarrativ spielen. Die Aussage war von metaphorischem Charakter und wurde zu einem Grundbaustein für die diagnostische Hypothesenstellung und das Kennenlernen der Familie.
Die Therapie wurde auf Empfehlung eines Dermatologen begonnen, der der jugendlichen Tochter, die unter psychosomatischen Beschwerden litt, eine Psychotherapie angeraten hatte. Während der Therapiesitzung berichteten die Eltern, dass sich ihre Tochter isoliere, sich zurückziehe und viel allein sei. Nach mehreren Familiensitzungen, bei denen auch das zweite, jüngere Kind anwesend war, verringerten sich die Symptome des Mädchens deutlich und es wurde etwas offener und zugänglicher. Die Mutter begann, mehr Zeit mit der Tochter zu verbringen. Sie gingen gemeinsam außer Haus, erledigten miteinander die Einkäufe und machten gemeinsam Sport. Als sich eine stabile Beziehung zwischen Mutter und Tochter entwickelt hatte, entschied der Therapeut, eine Sitzung nur mit den Eltern durchzuführen. Bei diesem Treffen sollte es um Ängste und Befürchtungen der Eltern in Bezug auf ihre elterlichen Pflichten gehen. Während der Sitzung fragte der Therapeut, wovor die Eltern die meiste Angst hätten. Völlig unerwartet antwortete der Vater: »Ich habe Angst, dass unsere Tochter uns eines Tages absticht.«
Dieser Satz rief beim Therapeuten Erstaunen hervor, denn bisher hatte nichts auf ein hohes Aggressionslevel in der Familie hingewiesen. Im Gegenteil, das Thema Wut, Gewalt oder Aggression war überhaupt nicht aufgetaucht. Die Mutter war so damit beschäftigt, von ihren eigenen Ängsten zu berichten, dass sie die Worte ihres Mannes anscheinend gar nicht gehört hatte. Als der Vater gefragt wurde, was er denn mit seiner Aussage gemeint hätte, bemühte er sich, sie zu bagatellisieren. »Nichts weiter, das ist mir so herausgerutscht, meine Tochter hat manchmal Wutanfälle, aber so ist das eben bei Kindern.«
Die kurze Aussage des Vaters wurde zur Grundlage dafür, dass drei mögliche Hypothesen bezüglich versteckter generationsübergreifender Aggressionen aufgestellt und später untersucht wurden. Die erste Hypothese: Der Tochter widerfuhr irgendwann bzw. widerfährt weiterhin etwas, wofür sie sich mit mörderischen Impulsen rächen könnte. Die zweite Hypothese war die, dass der Vater sich und seine Tochter mit anderen Personen in der Familie verwechselte (Halluzination). Das konnte bedeuten, dass sich im System ein dramatischer Vorfall ereignet hatte, aufgrund dessen die Elterngeneration aggressive und mörderische Impulse vonseiten des Kindes erwartete. Die dritte Hypothese wäre im Prinzip eine Verbindung aus den beiden vorangegangenen Hypothesen: Ein Drama, das sich in früheren Generationen ereignet hatte, wiederholte sich in der jetzigen Familie und spielte sich weiterhin dort ab. Diese Hypothese bedurfte einer weiteren Verifizierung, um dann anschließend in den Bereichen der in der Familie dominierenden Trancephänomene – Amnesie, Halluzination und Altersregression – arbeiten zu können.
Ein weiteres Beispiel dafür, welche Rolle die Metapher in der Therapie spielt, ist folgende Geschichte aus der Einzeltherapie von Frau E.:
Frau E., die sich seit einigen Monaten in Therapie befand, sagte während einer Sitzung ganz unerwartet: »Jetzt kann ich ja darüber sprechen: Bei mir zu Hause steckt ein Familiengeheimnis im Schrank.« Vor einigen Wochen hatte sie dort eine gut versteckte Schachtel mit Damenunterwäsche gefunden. Die Wäsche gehörte ihrem Mann. Heimlich zog er sie an, wenn seine Frau nicht zu Hause war. Die erste Ebene der Metapher »Familiengeheimnis« führte zur Arbeit an bisher verdeckten Aspekten der ehelichen Beziehung.
Der aufmerksame Therapeut interpretierte die Aussage von Frau E. als einen Hinweis, der sich nicht nur auf die aktuelle Familie bezog, sondern möglicherweise auch auf Geheimnisse in der Herkunftsfamilie der Klientin hindeutete. Die Metapher der »im Schrank versteckten Schachtel« wurde als Signal betrachtet, den bisherigen Bereich der Halluzination zu verlassen und Dinge, die bis dahin nicht wahrgenommen worden waren, zu sehen und darüber zu sprechen. Halluzination war bei Frau E. das dominierende Trancephänomen. Auch in der Familie der Klientin dominierte das Trancephänomen der Halluzination, sowohl in der, die sie gemeinsam mit ihrem Mann gegründet hatte, als auch in der Familie, in der sie aufgewachsen war. Nachdem aufgedeckt worden war, welche Ereignisse in der aktuellen Familie von Frau E. vorgefallen waren, und im nächsten Schritt der Therapie, was sich in der Herkunftsfamilie der Klientin ereignet hatte, konnte die Schutzfunktion der Halluzination erkannt und mit der therapeutischen Behandlung begonnen werden. Ziel der Therapie war es, die Halluzination aufzulösen und eine Hinwendung zur Wirklichkeit zu erreichen.
Herr F. war seit fünf Jahren verheiratet und hatte einen einjährigen Sohn. Er wurde mit der Diagnose Depression zur Psychotherapie überwiesen. Herr F. war noch nie stationär behandelt worden. Außer, dass er an Schlafstörungen und seit fast zwei Jahren an Müdigkeit litt, das Gefühl hatte, sein Leben hätte keinen Sinn und über das Nachlassen seiner Libido klagte, beklagte sich der Klient über die schwierige Beziehung zu seiner Frau. Herr F. meinte, die Beziehung hätte sich deutlich verschlechtert, seit seine Frau schwanger geworden war. Nach der Hochzeit hatte Herr F. mit dem Hausbau begonnen, nach zwei Jahren war das Haus fertig. Mehr als zehn Stunden täglich hatte er gearbeitet, damals hatte er genügend Energie und fühlte sich gut. Die meisten Arbeiten am Haus waren nach Feierabend vom Klienten selbst verrichtet worden. Der Hausbau war für Herrn F. ein gewaltiges Stück Arbeit gewesen, vor allem, da er, wie er es ausdrückte, »im Sumpf« gearbeitet hatte. Der Therapeut, den die Berichte vom Hausbau »im Sumpf« aufmerken ließen, unterbrach die Erzählung des Klienten und fragte ihn, was er mit seinen Worten meinte. Herr F. erklärte, er hätte das Haus auf dem Grundstück gebaut, dass er von seinen Eltern geerbt hatte. Ein Teil des väterlichen Landbesitzes war Sumpfgebiet. Dadurch war das Grundstück nicht viel wert und Herr F. hatte den Sumpf zuschütten müssen, was sehr arbeitsaufwendig und kostspielig gewesen war. Während der folgenden Sitzungen berichtete der Klient etwas mehr über seine Herkunftsfamilie. Sein Vater hatte viele Jahre Alkoholprobleme gehabt, seine Mutter wiederum war gewalttätig gewesen, sowohl dem Ehemann als auch den Kindern gegenüber. Alle hätten Angst vor ihr gehabt, und der Klient trug diese Angst, obwohl seitdem so viel Zeit vergangen war, weiterhin in sich. Diese Angst erkannte er auch in der Beziehung zu seiner Frau wieder, die, wie er meinte, damit drohte, ihn zu verlassen und das Kind mitzunehmen. Schrittweise wurde klar, dass sich die Worte »ich habe das Haus auf einem Sumpf gebaut« nicht nur auf den sumpfigen Baugrund, sondern auch auf die problematische und schmerzliche familiäre Vergangenheit von Herrn F. bezogen, die der Klient aus seiner Herkunftsfamilie in die aktuelle Familie übertrug.
An diesem Beispiel wird sowohl deutlich, dass der Klient in der Vergangenheit verharrt, als auch, dass er die Gegenwart ignoriert. Darüber hinaus sind Hinweise bezüglich einer Diagnose des familiären Systems enthalten. Viele Beschreibungen enthalten metaphorische Botschaften, die wichtig sind, um den Klienten zu verstehen. Dazu gehören auch die beiden Schlüsselwörter »Haus« und »Familie«. Eine scheinbar völlig nebensächliche Aussage, in der es darum geht, wie der Klient die Ferien verbringt, etwa »im Sommer fahre ich immer nach Hause«, kann darauf hindeuten, dass er seine Herkunftsfamilie mehr als zu Hause betrachtet, als die Familie, die er selbst gegründet hat, und dass die Bindung zu Personen aus der Vergangenheit stärker ist, als die zum eigenen Lebenspartner. Es kann wichtig sein herauszufinden, was mit den Worten »meine Familie« gemeint ist. Sind damit der Partner oder die Partnerin und die eigenen Kinder gemeint? Oder aber die Eltern und Geschwister? Der Begriff »Familie« kann auch Heimat bedeuten, das Gefühl, mit einer sozialen, ethnischen, nationalen oder religiösen Gemeinschaft verbunden zu sein. Das Wort »Haus« wiederum bezieht sich meist auf ein Gebäude, enthält aber auch andere Bedeutungen. Man kann zufrieden damit oder aber unglücklich darüber sein, aus welchem Hause man stammt. Ein Haus kann ungemütlich und zu eng sein, oder aber sicher und bequem. Entweder fühlt man sich »wie zu Hause« oder »wie auf gepackten Koffern«. Jemand hat nur »eine Ecke für sich« (z. B. bei den Schwiegereltern), hat »kein Dach über dem Kopf« oder »findet keinen Raum für sich«. Jegliche Berichte des Klienten zum Thema Haus oder Renovierungen am Haus (in Schlafzimmer oder Küche), zum Thema Hausbau oder Umzug enthalten, vor allem wenn sie bei einer Familientherapiesitzung angebracht werden, weitere versteckte Ebenen.
Читать дальше