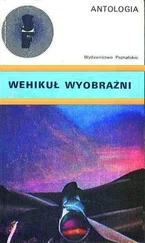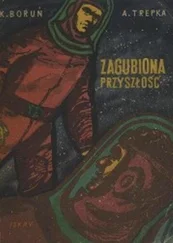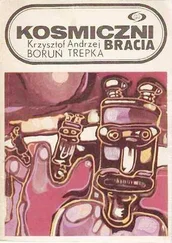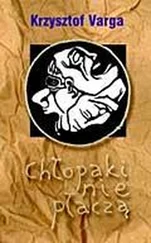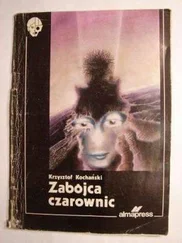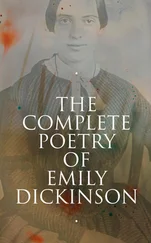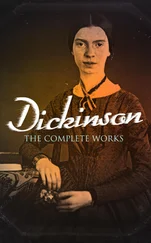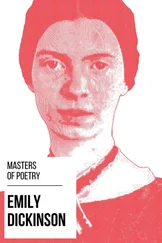Manche Klienten beherrschen die Sprache der Metaphern fließend. Fragt man sie nach dem Ziel der Therapie, so geben sie zur Antwort »ich würde gern meinen Garten von Unkraut befreien«, »ich möchte in meinen Schubladen aufräumen« oder »ich will endlich die Sachen unter dem Teppich hervorkehren«. Existiert ein Familiengeheimnis, so hat man »eine Leiche im Keller« und der Satz »Nun wissen wir, wo der Hund begraben liegt« bezieht sich sicher nicht auf die Tierwelt.
Carl Gustav Jung beschreibt es so (Erickson a. Rossi 2014, pp. 49–50):
»Ein Symbol bedeutet nicht einfach, dass ein Objektes durch ein anderes ersetzt wird. Es ist vielmehr eine sehr gute Darstellung dessen, was im Prozess des Bewusstwerdens geschieht.«
Eine Metapher verdeutlicht also, dass sich das Bewusstsein auf dem Gebiet, das mithilfe der Metapher beschrieben wurde, in einem Evolutionsprozess befindet – auf einer Reise vom Unbewussten ins Bewusste, oder aber in die entgegengesetzte Richtung, vom Bewussten ins Unbewusste.
Ein Klient beginnt dann eine Therapie, wenn er auf bewusster Ebene nicht in der Lage ist, mit seinen (unbeabsichtigt erworbenen) Beschränkungen zurechtzukommen. Tauchen in der Erzählung des Klienten Metaphern auf, so ist das ein vielversprechender Hinweis darauf, dass innere Veränderungen bereits begonnen haben. Während des Therapieprozesses kann eine Metapher Einsichten voranbringen, die Bereitschaft signalisieren, sich an neue Einsichten anzunähern, und dann zur Entwicklung neuer Bedeutungen, eines neuen Verständnisses sowie zu Veränderungen auf bewusster Ebene führen. Dies ist weder die einzige noch die wichtigste Arbeitsweise mit der Metapher. Stützt sich die therapeutische Arbeit auf Symbole und Metaphern, kann das zwar zu Veränderungen auf bewusster Ebene führen, es kann aber auch
»einen immensen Einfluss durch eine Aktivierung unbewusster Assoziationsschemata ausüben« (O’Hanlon 1993, pp. 128–129).
Die Antwort, also die Reaktion auf eine metaphorische Botschaft des Therapeuten, hat ebenfalls diagnostische Bedeutung, denn sie liefert Informationen darüber, ob es für den Klienten einfacher ist, zu einem Thema auf bewusster oder auf unbewusster Ebene zu arbeiten.
Im ericksonschen Konzept, auch bei der Arbeit mit Metaphern, wird die Therapie oft auf der Ebene von Symbolen durchgeführt, und Veränderungen geschehen im Bereich des Unbewussten. Dies ist auch bei Kindern der Fall, die eine Therapie beginnen, um bestimmte Symptome zu reduzieren (Signer-Fischer, Gysin und Stein 2009). Möchte der Therapeut den Klienten dazu animieren, seine Symptome in metaphorischer Weise zu beschreiben, kann er ihm beispielsweise folgende Fragen stellen:
•Womit könnten Sie Ihre Symptome vergleichen?
•Sind Ihre Beschwerden wie ein Tisch, wie ein Stein, wie Nebel …?
•Welche Farbe hat Ihr Symptom?
•Wie treten Ihre Symptome auf? Wie Rauch oder eher wie ein Blitz?
•Welche Größe hat Ihr Symptom? Passt es in einen Fingerhut, auf einen Teelöffel oder auf einen Esslöffel?
Je mehr Kreativität der Therapeut hierbei entwickelt, desto mehr wichtige Informationen erhält er, die er später in der Trancearbeit verwenden kann. 6Indem er spontan Metaphern verwendet, teilt der Klient ein wesentliches Fragment seines Unbewussten mit dem Therapeuten. Das kann als Aufforderung verstanden werden, die Arbeit auf der Ebene des Unbewussten fortzuführen, wobei die Hypnose ein nützliches Werkzeug darstellt. Gleichzeitig signalisiert der Klient auf diese Weise, welche Arbeitssprache er für sich für geeignet hält und welche Vergleiche und Symbole, die nicht direkt benannt werden und keiner bewussten Beschränkung unterliegen, diese Sprache beinhalten soll.
Der Therapeut sollte abwägen, wie er mit der Metapher bezüglich diagnostischer Aspekte umgeht. Ermöglicht es die Metapher, dass der Klient ein besseres Verständnis für die eigene Person entwickeln kann? Wenn ja, sollte dann die Arbeit auf das Wachstum des Bewusstseins gelenkt werden? Diese Strategie ist beispielsweise bei Klienten nützlich, die in der Vergangenheit verharren. Ein Attribut des Erwachsenwerdens ist es, dass sich bei einer Person ein Verständnis für sich selbst und für die Welt entwickelt, außerdem bildet sich ein bewusstes Reflektieren heraus. Dennoch ist es manchmal besser, im Bereich des Unbewussten zu bleiben – etwa dann, wenn die Arbeit auf bewusster Ebene für den Klienten zu schwierig oder zu schmerzhaft ist, oder aber schon früher über lange Zeit nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
Der Bereich der Metapher ist nicht nur in der Diagnostik sinnvoll, Metaphern werden auch oft für therapeutische Interventionen verwendet. Wenngleich sich meine Arbeit darauf konzentriert, wie der Therapeut nach dem ericksonschen Ansatz den Klienten wahrnimmt, und die Konsequenzen der aus der Diagnose entwickelten Therapiestrategien nicht Thema dieses Buches sind, möchte ich hier dennoch ein Beispiel für die Verwendung einer Metapher anbringen:
»Ein 85-jähriger jüdischer Mann heiratet eine 25-jährige Frau. Nach einem halben Jahr ist die Frau schwanger. Der Mann geht zu einem Rabbi, um Rat einzuholen: ›Rabbi, was meinst du? Ist das Kind wohl von mir?‹
Der Rabbi antwortet: ›Dazu muss ich dir eine Geschichte erzählen. Ein älterer englischer Gentleman liebt die Großwildjagd. Er bucht eine Reise nach Afrika und geht dort auf die Jagd. Eines Morgens steht er früh auf und geht in den Dschungel auf die Pirsch. Mitten im Dschungel stellt er fest, dass er statt seines Jagdgewehrs seinen Regenschirm mitgenommen hat. Er hat nicht allzu viel Zeit, über seine Vergesslichkeit zu philosophieren. Plötzlich steht in unmittelbarer Nähe ein Löwe vor ihm, der unruhig mit seinem Schwanz peitscht. Reflexartig reißt der ältere Herr seinen Schirm hoch und legt an. Ein Knall ertönt, und der Löwe sinkt tot zu Boden.‹
Der Rabbi schweigt und schaut dem 85-jährigen Frager ins Gesicht. Dieser meint schließlich: ›Aber das kann doch nicht sein!? Da muss doch einer von der Seite geschossen haben!‹
Der Rabbi sagt: ›So sehe ich das auch‹« (Trenkle 2000).
Ein Symptom kann eine Metapher sein, die Prozesse widerspiegelt, die im Individuum oder in auch in einer Familie ablaufen.
Jan war zwölf Jahre alt und hatte noch einen jüngeren Bruder. In der Schule verhielt sich Jan aggressiv. Der Lehrerin gegenüber war er frech und hielt sich nicht an ihre Anweisungen. Als die Mutter deswegen in die Schule bestellt wurde, war sie nicht überrascht. Auch ihr gegenüber verhielt sich der Junge aggressiv, er benutze Schimpfwörter, einige Male hatte er seine Mutter sogar getreten. Zwischen Jans Eltern gab es seit fast einem Jahr Streit. Die beiden standen kurz vor der Scheidung, die von der Mutter eingereicht worden war. Jans Vater hatte beim Familiengericht das alleinige Sorgerecht für die beiden Söhne beantragt, damit war die Mutter nicht einverstanden. Die offen zutage tretende Aggression des älteren Sohnes war Spiegelbild der eher versteckten Aggression seines Vaters.
Hat ein Kind Angst, zur Schule zu gehen, kann diese Angst des Kindes Ängste der Mutter widerspiegeln, die sich davor fürchtet, mit einem Bereich der Gesellschaft außerhalb ihres Zuhauses konfrontiert zu werden. Immer wiederkehrende intensive Konflikte eines Vaters mit seiner jugendlichen Tochter können eine Metapher dafür sein, dass es früher starke Auseinandersetzungen des Vaters mit der Mutter der Tochter gab. Trägt eine Familie einen heftigen Konflikt mit der Tochter aus, wobei vor allem die Reaktionen der Tochter bei den Erwachsenen Beunruhigung auslösen, kann dies zu einer gegenseitigen Annäherung der Eltern führen, zumindest, wenn es um die Sorge um das gemeinsame Kind geht.
Werden Interaktionen innerhalb einer Familie beschrieben, tauchen oft metaphorische Beschreibungen wie beispielsweise Ehegeplänkel oder Familienbande auf. Solche Beschreibungen spiegeln die gegenseitigen Abhängigkeiten aller Personen im System wider.
Читать дальше