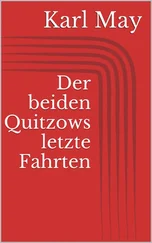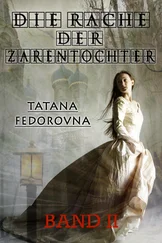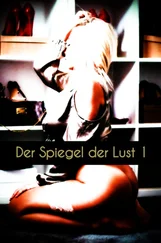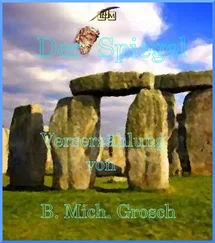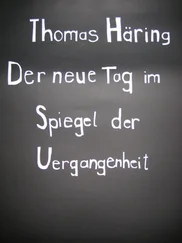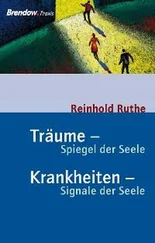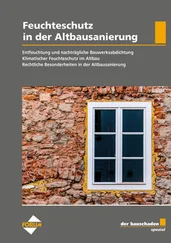So aber hielt Bertel Castan die Zeit einfach an, indem er schwieg und geradeaus starrte. Mit jeder Sekunde der Erstarrung wurde es schwerer, das Schweigen aufzubrechen. Onkel Bertel, soviel war Eugen Saller klar, wenn er jetzt über diese angespannte Situation, von der ihm der Dorfbüttel erzählt hatte, so nachdachte, Onkel Bertel musste schon damals als ziemliche Respektsperson im Dorf gegolten haben. Das war gewiss auch dem Büttel gegenwärtig, der wie alle Hilfskräfte in einer untergeordneten Position, die sie über viele Jahre hinweg haben halten können, ein feines Gefühl dafür herausgebildet hatte, mit wie viel Respekt, Vorsicht und Zurückhaltung man einer Person, mit der man dienstlich zu tun hatte, begegnen musste, aber auch wie viel Mitgefühl oder Zustimmung oder Herzlichkeit ihr gegenüber aufzubringen schicklich war. Darum konnte er als ein gewöhnlicher Gemeindediener dem Herrn Castan jetzt doch nicht einfach ins Wort fallen – wiewohl dieser ja bis jetzt noch nicht ein Wort gesprochen hatte.
Wie beredsam war Bertel Castan doch gewesen, als er aus Chicago zurückgekommen war! Dort hatte er, jüngstes Mitglied einer Regierungskommission der Franzosen, die industrielle Fleischproduktion der Amerikaner studieren sollen, die der handwerklichen Metzgerei hierzulande – unhygienisch und mittelalterlich (‚plein de microbes et absolument moyenâgeux‘) , wie er immer wieder betont hat – weit voraus war.
Bald danach hatte er den ehrenvollen Auftrag erhalten, einen vollmechanisierten Schlachthof nach amerikanischem Vorbild in Paris zu entwerfen. Eugen erinnerte sich noch an die Postkarten mit dem Eiffelturm drauf, die Onkel Bertel an Mutter geschrieben hatte. Der Schlachthof ist später zu einem Treffpunkt europäischer Schlachthofdirektoren geworden.
In einem modernen Schlachthof amerikanischer Art hatte Bertel Castan vor allem die Weiterverarbeitung in ihrer Sauberkeit und in ihrer Präzision fasziniert und die klare Vorhersehbarkeit der Abläufe, er hatte das leise Tak-tak-tak-tak der Gliederketten im Ohr, von denen die Tiere, in gleichen Abständen aufgereiht, herabhingen und sekundengenau zu den einzelnen Stationen transportiert wurden.
Umso mehr hatte er das Chaos, den Schmutz und das Blut auf den Schlachtfeldern gehasst, die Zufälligkeiten, die unvorhergesehenen Rückschläge und unverhofften plötzlichen Durchbrüche und den ungewissen Ausgang; wobei in den meisten Schlachten ja beide Seiten verloren – Bataillone, Geschütze, Schiffe, Flugzeuge –, die einen ein paar mehr, die anderen ein paar weniger, die hielten sich dann für die Sieger.
Schließlich hatte der unglückliche Überbringer der Todesnachricht dann doch noch seinen Mund aufgebracht, nur um etwas zu sagen, nur um der Stille zu entkommen, denn irgendwie musste das Gespräch weitergehen, irgendwie musste er herausfinden aus dieser Folter, die unerträglich war, obwohl sie aus nichts anderem als aus Schweigen bestand, und er stammelte, als ob das ein Trost sei für Bertel: „Es war in der letzten Schlacht am Hartmannsweillerkopf –“
Da fuhr Bertel hoch: „– geschlagen von Dilettanten, deren einzige Qualität die einfallslose Zähigkeit war, die sture Verbissenheit, sonst nichts, nichts! Reine Schlachtfelddirektoren und Tötungsingenieure, aber stümperhafte, die den Tod des einzelnen dem Zufall überließen!“
Der Tod des einzelnen, das erschien dem Büttel zu wenig tröstlich für Herrn Castan und wie zur Ergänzung fügte er an: „Über dreißigtausend Tote allein auf französischer Seite!“, damit Herr Castan sähe, wie wenig er allein war in seiner Trauer.
Um sich eine Vorstellung zu verschaffen, fing Bertel, in alter Gewohnheit und ohne es eigentlich zu wollen, damit an, im Kopf das Schlachtgewicht zu überschlagen und murmelte: „Das sind an die 2000 Tonnen Soldaten –“, und als ihn der Büttel bestürzt anblickte, da brüllte es aus ihm heraus: „Hab’ ich denn das grausige Wort Schlacht erfunden? Da sagst du nichts –“
Die heftigen Worte seien unvermittelt in ein ebenso lautes Schluchzen übergegangen, aber schon nach wenigen Augenblicken habe sich Bertel Castan wieder in der Hand gehabt. –
Ein Geräusch, nah hinter ihm, ließ Eugen Saller aufschrecken. Das musste Le Chef sein, der immer sehr früh aufstand, lange vor dem Wecken und meistens mit Gepolter. Da rief er ihn auch schon, stimmlos, weil noch alles schlief, und dennoch laut:
„Öschänn, Öschänn! Chumm schnall!“
„Buschur“, brummte Eugen und dachte, der bellt sogar dann noch wie ein Preuß, wenn er flüstert, und ging mit dem Chef ins Haus, wo sie im Schlafraum alle dicht nebeneinander lagen.
„Hör’ dir das an, Öschän“, kicherte Le Chef vergnügt, „die schnarchen wieder alle im gleichen Takt!“
Tatsächlich, so war es – nicht zu glauben! Eugen lauschte, ob sich nicht wenigstens ein einziger Abweichler fände, vergebens. Doch Serges Schnarchen schien ihm derart übertrieben – er setzte die Pausen nach dem Ausatmen so überdeutlich und variierte die Übergänge so kunstvoll –, dass Eugen im Halbdunkel leise zu Le Chef hinüberfragte: „Ob die Quatsch machen? Die wollen uns verarschen“, wobei ihm im selben Augenblick aufging, dass es vielleicht etwas dreist war dem Chef gegenüber, von ‚uns‘ zu sprechen, zumal ihm Zweifel kamen, ob nicht Le Chef selbst mit dahinterstecken könnte. Nichts fürchtete er mehr, als ausgelacht zu werden.
„Nein, nein“, rief Le Chef, nun überzeugend laut, „das gibt’s immer wieder mal, wahrscheinlich sogar ein paar Mal jede Nacht, nur hört es dann halt niemand.“
Wenn ich das daheim erzähle, das glaubt mir keiner, dachte Eugen.
„Bass uff, Öschän, ich studier’ das schon lang. Jeder ist mit jedem verbunden, mit dem einen enger, mit dem anderen nicht so fest . Jeder hört jeden, auch im Schlaf, den einen mehr, den anderen weniger, und jeder wird von jedem gehört, vom einen deutlicher, vom anderen schwächer – aber nur ein bisschen schwächer. Steigt ein Kleinschnarcher mal aus – weil er schlucken muss oder sich umdreht –, dann hält er das nicht lange durch. Er fasst, so schnell er kann, wieder Tritt, auch wenn er für sich allein vielleicht eine Spur schneller oder langsamer atmen würde. Gewöhnlich fängt er dann etwas leiser mit dem Schnarchen wieder an und erst, wenn er genau auf die anderen eingeschwungen ist, schnarcht er wieder voll mit. Die lauten Großschnarcher wie Serge, das sind die tonangebenden. Die können alles durcheinanderbringen. Wenn die aus dem Takt fallen, dann kann es lange dauern, bis alle wieder im Gleichtakt sind. Es wird dann viel leiser im Raum, so, als ob alle unsicher lauschten, wo die anderen sind und wo man sich am ehesten mit dranhängen kann und wem man im Traum am ehesten die Hand geben könnte, um nicht so allein zu sein in der Nacht.“
Und nach einer Pause: „Manchmal kann ich beim Zuhören fast spüren, wie es sich dann viel leichter atmet, wenn sie alle wieder beieinander sind und nicht jeder stolpernd seinen Platz suchen muss und dabei dauernd mit einem anderen zusammenstößt.“
Le Chef blickte ihn dabei nachdenklich an, und Eugen Saller wiederholte murmelnd, wie um zu zeigen, dass er alles verstanden habe: „Jeder ist irgendwie mit jedem verbunden, ohne dass er das merkt –“
„Aber“, sagte Le Chef, „so ist das auf der ganzen Welt – mit allem! Nur sieht man’s nicht so deutlich wie hier beim Schnarchen, wo sie alle so dicht beieinanderliegen.“
Trotzdem war sich Eugen Saller erst viele Jahre später sicher, dass das damals wirklich so war, wie es ihm Le Chef erklärt hatte, und ihm da nicht ein Theater vorgespielt worden ist. Aber so harmlos wie am Hartmannsweilerkopf, wo schlafend einer am anderen baumelte und es nur um das Schnarchen ging, war das dann gar nicht mehr. –
Читать дальше