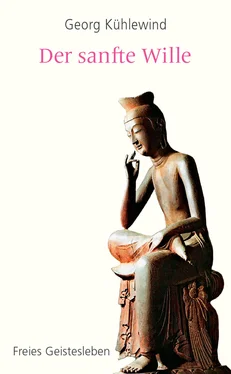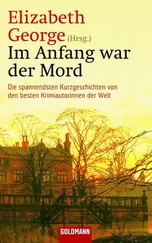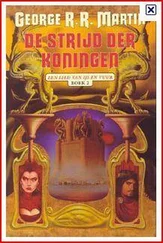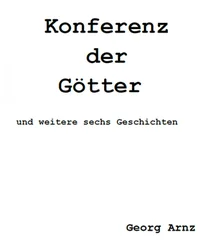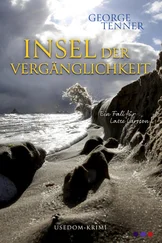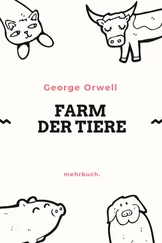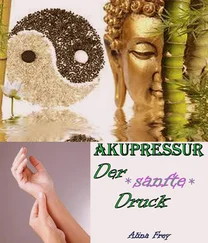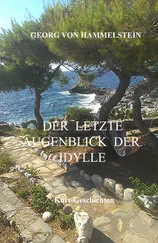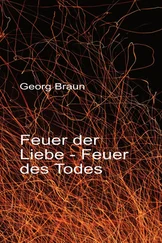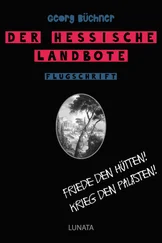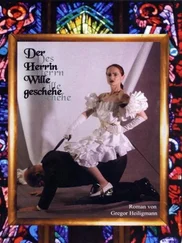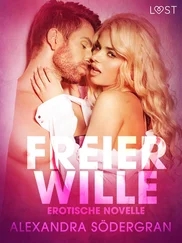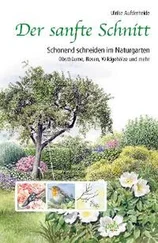Wir leben in einer Welt der Bedeutungen , während wir doch überzeugt sind, in einer Welt der Dinge zu leben. Aber jedes Ding hat Bedeutung – man sage mir ein Ding, das ohne Bedeutung wäre. Sobald wir es nennen können, ist es schon nicht mehr ohne Bedeutung. Zunächst erfassen wir die Bedeutung durch das Denken, wir versuchen es. Auch schaffen wir manchmal neue Bedeutungen.
Wir wissen aber nicht, wie wir denken .
Nur das schon Gedachte wird uns bewusst.
Für das Kleinkind, für archaische Menschen, für einzelne engelartige Menschen, 2 wie den heiligen Thomas von Aquin, besteht die Wirklichkeit aus und in den Bedeutungen. Diese gehen in der menschlichen und nach der Tradition in der göttlichen Praxis den einzelnen Dingen voraus: Erst ist die Idee des Dinges da, dann das Ding, erst die Bedeutung, dann das Zeichen. Das gilt auch für die Gedanken, sofern sie im Zeichen erscheinen.
Die Bedeutungen sind stofflos. Die Zeichen bestehen aus konfigurierter Stofflichkeit, wie Luftwellen, Tinte, körperliche Gebärden. Daher geht Verstehen auch stofflos vor sich, stofflose Bedeutung kann nicht durch stoffliche Vorgänge «verstanden» werden. Auch der Verstehende in uns ist stofflos.
Stoffliche Zeichen werden zu stofflosen Bedeutungen gelesen. Denken, Gedanken, Denkender sind unstofflich.
Das erste Ziel wäre, das Denken zu erfahren. Denn das denkende Wesen selbst, durch das die Bedeutungen geschaffen, verstanden werden, bleibt zunächst verborgen.
Es ist an der Zeit, das Licht, das alles sichtbar macht, das Bedeutungslicht, das Licht des Wortes in Erfahrung zu bringen.
I.
Vom Gedanken zum Denken
Gedanken über das Denken
Wir wissen ebenso wenig, wie wir denken, wie wir beim Sprechen eine Bewusstheit über die Tätigkeit der Sprachorgane haben. Was uns bewusst wird, ist der fertig-gedachte Gedanke, das Wie seines Zustandekommens ist uns verborgen. Das kann zweierlei Gründe haben. Wir sind im Prozess des Denkens nicht bewusst – das wäre schon Grund genug, über sein Wie im Dunkeln zu bleiben. Der andere Grund könnte sein, dass wir im Denken so aufgehen, so identisch mit dem Prozess sind, dass keine beobachtende Instanz übrig bleibt.
Besinnung 1: Wir wachen im Bewusstsein auf, wenn das Denken schon vorbei und in Stillstand ist: im Gedachten .
Die Logik als Wissenschaft versucht die Gesetze, das Wie des Denkens zu formulieren – im Nachhinein. Wir denken schon logisch, ohne Logik studiert zu haben, so wie wir die Muttersprache auch ohne grammatische Kenntnisse richtig zu sprechen imstande sind. Außerdem, eben deshalb, bezieht sich die Logik auf die schon ohne sie erschienenen logischen Formen, Denkbewegungen, jedenfalls auf ein begriffliches Denken, ähnlich wie die Grammatik auf die schon gesprochene Sprache. Daher kann die Logik nie endgültig oder fertig sein: Denn der Mensch kann immer neue logische Wendungen hervorbringen.
Besinnung 2: Erst ist logisches Denken da, dann Logik als Lehre. Erst ist die Sprache da, dann ihre explizite Grammatik .
Dass es das Denken als Prozess gibt, ist eine Folgerung aus dem Umstand, dass das Gedachte zunimmt und wechselt. Das können wir einsehen, weil wir über die Fähigkeit des Reflektierens verfügen, nämlich unsere Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit des Denkens – des Bewusstseins überhaupt – lenken können. Diese Fähigkeit ist uns ohne persönliche Arbeit, eigenes Bestreben oder Lernen gegeben. Wir schauen auf das Vergangene, schon erstarrte Denken aus der Gegenwart . Sie selbst erleben wir gewöhnlich nie, obwohl wir aus ihr auf die Vergangenheit und die Zukunft schauen. Indem wir auf diese schauen, heben wir sie in die Gegenwart – für einen homöopathisch kurzen Augenblick. Wir werden sie aber nur gewahr, wenn sie – auch die Bilder der Zukunft – wieder aus der Gegenwart, aus dem Denk- und Vorstellungsprozess ausgeschieden sind und als Gewordenes vor dem inneren Blick stehen, für eine Aufmerksamkeit, die aus der Gegenwart schaut.
Besinnung 3: Allein die Gegenwart ist Wirklichkeit . (Auch als Meditationsthema geeignet.)
Geistesgegenwart ist ein kurzes Aufblitzen zweier Elemente: Geist und Gegenwärtigkeit oder Intuition und Gegenwärtigkeit, plötzlich und ohne Nachdenken. Man kann sich fragen: Was hindert daran, immer oder wenigstens nach Belieben geistesgegenwärtig zu sein? Dieses seltene Erlebnis können wir im Nachhinein reflektierend beobachten: Es «fällt uns etwas ein», zum Beispiel die einzige Lösung einer gefährlichen Situation, und es ist fühlbar, dass die Lösung «gekommen» ist, wir haben daran nicht gearbeitet, nicht darüber nachgedacht – dazu ist meistens auch keine Zeit. Warum passiert das nur in Gefahr oder in anderen extrem wichtigen Situationen? Die Beobachtung zeigt, dass wir im Augenblick der Gefahr völlig konzentriert sind, die Aufmerksamkeit ist ganz in der Situation. Wäre vielleicht wenigstens ein Teil des Hindernisses, stets geistesgegenwärtig zu sein, dass unsere Aufmerksamkeit im Alltag so zerstreut ist? Dass sich das Denken auf vorgefertigten Bahnen, in fertigen Begriffen bewegt und vermischt mit anderen seelischen Elementen, wie Wunsch, Vorurteil, Voreingenommenheit und Ähnlichem, arbeitet? Dann wären zur Eliminierung der Hindernisse zwei Schritte notwendig: die Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit und die Reinigung des Denkens.
Besinnung/Meditation 4: Was heißt «dies» im Unterschied zu «das»?
Versuchen wir erst die Reinigung des Denkens – es wird sich zeigen, dass sie und die Konzentrierung auf dasselbe Ziel hinauslaufen. Durch das Denken über das Denken, so aufklärend es sein kann, bleiben wir auf einer Ebene mit dem Alltagsbewusstsein, wir vermehren lediglich die Objekte des Denkens, an seiner Qualität ändert sich nichts.
Eine Änderung kann nur durch Üben geschehen – auch jede Fähigkeit entsteht so.
Erster Übungskomplex: Reinigung des Denk- und Vorstellungslebens
Die «Reinigung» war in jeder Tradition der erste Schritt zur Ausbildung gesteigerter Erkenntnisfähigkeiten. Da in unserer Zeit das Denken / Vorstellen die einzige autonome Seelenfähigkeit ist, beginnt der Schulungsweg mit der Reinigung dieser Funktionen.
Wir nehmen ein einfaches Thema zum Denken / Vorstellen, zum Beispiel, was wir morgen oder heute voraussichtlich noch tun werden; oder was wir gestern getan haben; oder was der nächste Schritt in der Erziehung unseres Kindes sein sollte oder der nächste Schritt in der Lösung eines Problems. Es soll kein attraktives, interessantes Thema sein.
Wir beginnen, uns darüber Gedanken, Vorstellungen zu machen, und versuchen, alle Assoziationen, die von der Linie oder vom Netzwerk des Themas wegführen, zu vermeiden. Man kann dies auch so ausdrücken: Wir versuchen, kontinuierlich zu denken – nicht schubweise mit Unterbrechungen – und stets beim Thema – zu bleiben. Wir versuchen, auch auf die begleitenden Gefühle zu achten, indem wir sie das Denken / Vorstellen nicht beeinflussen lassen; der Vorgang soll so objektiv wie möglich verlaufen. Die begleitenden Gefühlsnuancen sollen bemerkt werden, den Denkvorgang aber nicht beeinträchtigen. Diese Übung kann fünf bis zehn Minuten dauern.
Ist sie beendet, so schauen wir auf ihren Verlauf zurück, registrieren die Abstecher und Unterbrechungen, auch die dabei aufkommenden Gefühle, und machen uns deutlich, wann oder wo sie in der innerlich erlebten Geschichte aufgetreten sind.
Wir wiederholen die erste Übung, aber nun mit einem uns sehr interessierenden, attraktiven Thema. Später vergleichen wir die erste mit der zweiten Übung und registrieren die Unterschiede in der Anzahl und Intensität der Ablenkungen und in der Qualität und Intensität der Gefühle. Das Ziel ist, in beiden Übungen die Kontinuität des Vorgangs zu erreichen.
Читать дальше