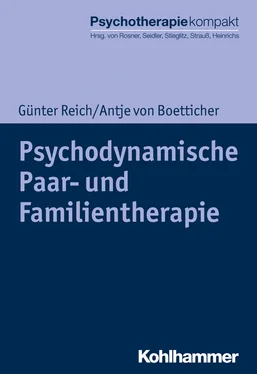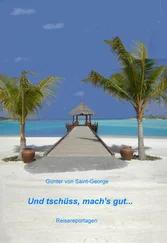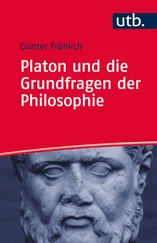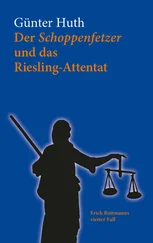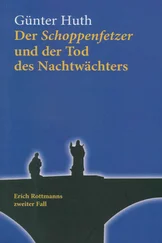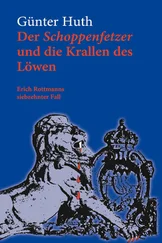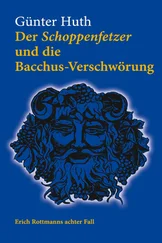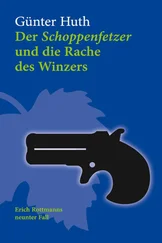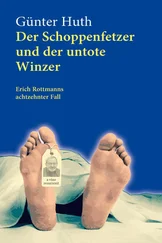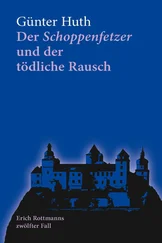Die Bedeutung familiärer und paardynamischer Prozesse für psychische Erkrankungen und körperliche Dysregulation belegen emprische Studien zu interpersonellen Prozessen wie dem »Spill-Over«, bei denen gezeigt werden kann, dass sich eheliche Spannungen der Eltern direkt auf Kinder übertragen, und Studien zur Kompensationshypothese. Sie zeigen sich auch zum Konzept der »Meta-Emotion«, in dem gezeigt werden kann, dass die Verbalisierung von unangenehmen Gefühlen durch Eltern es Kindern leichter ermöglicht, die negativen Folgen von elterlichen Konflikten zu bewältigen. Sie zeigen sich zudem in den Forschungen zur Parentifizierung (Chase 1999) sowie den Forschungen zur Bedeutung von Vätern und Geschwistern (vgl. Reich 2020 in Druck). Empirische Studien belegen zudem die mehrgenerationale Weitergabe einer ganzen Reihe von Problemen und problematischen Beziehungsmustern. Während diese Weitergabe in nichtgestörten Familiensystemen eher moderat ausfällt (Reich 2017; Reich et al. 2008), ist sie in gestörten Familiensystemen häufig erheblich und konnte in einer Reihe von Bereichen nachgewiesen werden, z. B. bezüglich der Bindungsmuster, der Erziehungseinstellungen, der Qualität der Ehebeziehungen, der Neigung zu Trennungen und Scheidungen, der Neigung zu Parentifizierungen, der Weitergabe von Traumafolgen und Gewalterfahrungen, bezüglich der Verletzung interpersoneller Grenzen sowie der Fähigkeiten zur Selbstregulierung (Reich et al. 2008; Reich 2020 in Druck). Auch in den Familien- und Paarbeziehungen wirksame Resilienzfaktoren wurden untersucht (Walsh 2016; Reich 2020 in Druck). Hierzu gehören gemeinsame Sinnfindung und Orientierung, Fähigkeiten zur Veränderung der Familienorganisation bei Einbrüchen wie z. B. Erkrankungen, kooperatives Elternverhalten, Respekt für die individuellen Unterschiede, die Fähigkeit zur Mobilisierung außerfamiliärer Ressourcen sowie Klarheit der Kommunikation und das offene Teilen schmerzlicher und freudiger Emotionen. Auch positive Paarinteraktionen wie verbale Unterstützung, Berührung oder Responsivität wirken salutogenetisch. Kinder profitieren zudem von stabilen Elternbeziehungen, klaren Generationsgrenzen, emotionaler Resonanz sowie davon, ob sie elterliches Verhalten, auch hochproblematisches, verstehen können oder nicht (vgl. Reich 2020 in Druck).
Familien- und Paartherapien haben sich zudem bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen als wirksam erwiesen. Dies gilt im Erwachsenenbereich für affektive Störungen, Angststörungen, Essstörungen, Substanzmissbrauchsstörungen und Psychosen, im Bereich der Behandlung von Kindern und Jugendlichen für Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Substanzmissbrauch und Essstörungen (von Sydow et al. 2010, 2013) ( Kap. 9).
4 Kernelemente der Diagnostik
4.1 Psychodynamische Paartherapie
Die Initiative für eine Paartherapie geht in der Regel stärker von einem Partner oder einer Partnerin aus. Selten ist die Motivation gleichmäßig verteilt. Dies kann sich hinderlich auswirken, jedoch auch diagnostische und therapeutisch nutzbare Hinweise ergeben. Erstes Kernelement der Paardiagnostik ist in diesem Sinne die Beachtung der Szene, analog zum Konzept des Szenischen Verstehens in der Einzeltherapie (Lorenzer 2006).
4.1.1 Die initiale Paarszene, Übertragung, Gegenübertragung, Arbeitsbündnis und Widerstand
Der Ansatz, den Informationen aus der Anmeldesituation und dem Erstgespräch Beachtung zu schenken, hat sich als äußerst fruchtbar erwiesen. Dabei interessieren uns Fragen wie:
• Wer meldet an, wer ergreift die Initiative?
• Wer beginnt das Gespräch, wer schildert und »definiert« womöglich das Problem?
• Wer hat ein »Problembewusstsein«?
• Stimmen die Schilderungen der Problemstellung einigermaßen überein oder unterscheiden sie sich sehr?
• Spricht das Paar vor allem miteinander oder mehr an die Therapeuten gerichtet?
• Wie erscheint das Paar: eher bedürftig, eher abgegrenzt-autonom?
• Welche Gegenübertragungsgefühle stellen sich ein? Unterscheiden sich diese zwischen weiblicher Therapeutin und männlichem Therapeuten?
Häufig meldet die Person an, die (scheinbar oder im eigenen Erleben) unbelastet von Symptomen im engeren Sinne ist, während die oder der andere als Symptomträger gekennzeichnet wird. Die Motivation zur Paartherapie ist dann nicht selten, die Symptome des oder der Einen zu bekämpfen, um die Belastung des oder der jeweils anderen zu vermindern.
Ein Paar meldet sich drängend an und sagt mehrere Termine kurzfristig ab. Jeweils fielen der Therapeutin der gehetzt wirkende Tonfall sowie eine wenig Widerspruch duldende Art, sich mitzuteilen, auf. Ein weiterer Termin musste aufgrund von Krankheit der Therapeutin verschoben werden. Als das Erstgespräch schließlich stattfindet, schildert das Paar vielfältige Schwierigkeiten, die sich aus den schweren »Kopfschmerzattacken« des Mannes ergeben. Weder seien längerfristige Wochenend- oder Urlaubsplanungen möglich, noch gäbe es ein befriedigendes Sexualleben, weil sie immer mit den »hereinbrechenden« Kopfschmerzen rechnen müssten. Medizinisch sei alles abgeklärt, Schmerzmittel helfen nur bedingt. Hinter dem betonten Mitgefühl der Ehefrau werden schnell Gereiztheit und aggressive Abwertung deutlich. Auch der Ehemann spricht »nebenbei« demütigende, abfällige Bemerkungen über seine Frau aus. Darauf von der Therapeutin angesprochen, wehren beide beschwichtigend ab: Wenn nur die Kopfschmerzen und die damit einhergehenden Einschränkungen verschwänden, gäbe es »wieder nur Harmonie zwischen uns«. Die weitere Exploration ergab, dass beide aus unterschiedlichen Gründen seit einigen Jahren beruflich zu kämpfen hatten und sich insgeheim gegenseitig schwere Vorwürfe machten. Die in den Anfangsjahren der Beziehung antriebsfördernde, eher belebend wirkende, ausgeprägte Konkurrenz zwischen den Eheleuten war nun lähmend geworden. Die Kopfschmerzen dienten als Externalisierung des Eheproblems. So konnte der »Schmerz« über die vielen Anstrengungen und Überforderungen des Alltags sowie die gegenseitige wütende Enttäuschung des Wunsches nach Entlastung aus der Beziehung herausgehalten und im Symptom »untergebracht« und gleichzeitig das unrealistische Ideal der immerwährenden Harmonie aufrechterhalten werden. Durch die Bearbeitung dieses Mechanismus verschwanden die Kopfschmerzen des Mannes zwar nicht vollständig, das Paar konnte jedoch den Umgang damit positiv verändern. Dazu gehörte ein freieres Aussprechen eigener Bedürfnisse und aggressiver Impulse. Der Widerstand war zu Anfang recht ausgeprägt, ein psychotherapeutisch-psychosomatisches Krankheitsmodell wirkte zunächst befremdlich. Die Reflektion der Szene vor Beginn der eigentlichen Gespräche ermöglichte eine Einfühlung in die innere Situation des Paares. Das Arbeitsbündnis konnte durch den Rückbezug auf die positiv besetzte Konkurrenz und deren Würdigung zu Beginn der Beziehung entwickelt werden.
Die szenischen Informationen erlauben häufig eine erste Hypothesenbildung über die Psychodynamik des Paares sowie der Widerstände gegen und Befürchtungen bezüglich einer Paartherapie. Hier gilt es auf der Therapeutenseite, die Unsicherheiten ernst zu nehmen, zu einer möglichst klaren Indikationsstellung zu finden und besonderes Augenmerk auf den Aufbau des therapeutischen Bündnisses zu legen, das eben das Paar »als Patienten« versteht. Dies sollte mit einem hohen Maß an Transparenz und Information über die Arbeitsweise einhergehen, wodurch in aller Regel diffuse Befürchtungen hinsichtlich eines paarorientierten Therapieansatzes gemindert werden können.
Die Analyse der initialen Szene einer Paartherapie gibt wertvolle Hinweise für die psychodynamische Hypothesenbildung. Dabei wird das Konzept des Szenischen Verstehens (Lorenzer 2006) auf die Paarsituation modifizierend übertragen.
Читать дальше