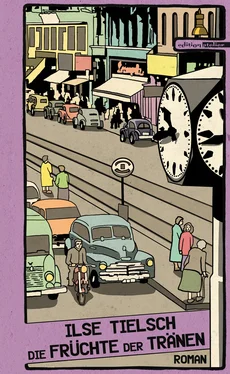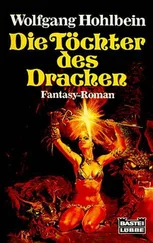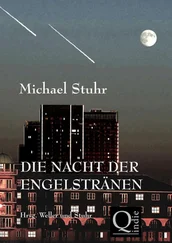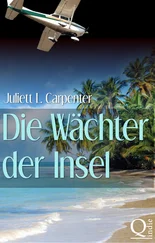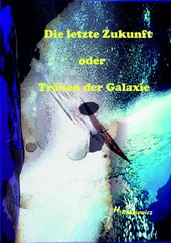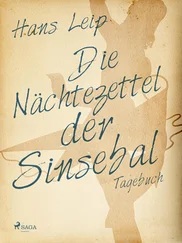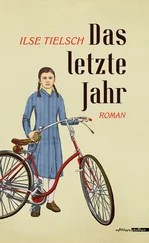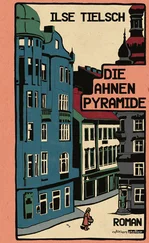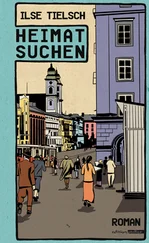Ich habe den Verdacht, sagte Bernhard schließlich, daß wir es auf solche Art nicht zu Reichtum bringen werden.
Würdest du gerne wie dieser Plotzner sein, fragte Anni.
Nein, sagte Bernhard, das nicht.
Da kommt Judith, sagte Anni.
Judith bog eben um die Ecke der Halle, in der die Haushaltsgeräte ausgestellt waren, die von vielen bewundert wurden und die kaum jemand kaufen konnte, weil sie zu teuer waren, sie kam auf die beiden zu. Sie trug einen roten Rock zur weißen, schulterfreien Bluse, das dunkle Haar hatte sie auf dem Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der Pferdeschwanz wehte im leichten Wind, der weite Rock flatterte, sie sah sehr hübsch aus, und die Leute drehten sich nach ihr um. Man hatte, was Kleidung betraf, in jener Zeit nur geringe Möglichkeiten, jedenfalls wenn man arm war und wenn man dazu auch nicht auf Bestände zurückgreifen durfte, die Mütter oder Tanten über den Krieg gerettet hatten und die man umarbeiten konnte. Judith aber gelang es immer, irgendwo ein Stück Stoff zu bekommen, aus dem ein Kleidungsstück zu fertigen war, sie nähte sich ihre Kleider selbst, und da sie keine Nähmaschine besaß, nähte sie mit der Hand. Aus einer alten Decke zauberte sie eine Jacke, aus einem Tischtuch, einem Vorhang eine Bluse oder ein Kleid, sie brachte es fertig, immer auf eine besondere Art modisch gekleidet zu sein, und sie genoß es, dadurch die Blicke auf sich zu ziehen und auf angenehme Art aufzufallen.
Hallo, sagt Judith, was macht ihr da.
Bernhard berichtete, was sich ereignet hatte.
Da wäre ich gern dabeigewesen, sagte Judith.
Anni, auch Judith, sind aus der Erinnerung aufgetaucht und verschwinden wieder. Zurück bleibt ein von Karl Plotzner gesprochener Satz, der als Brücke zu jenen Geschichten benützt werden kann, die erzählt werden müssen, damit aus einzelnen aneinandergefügten, miteinander verwobenen Teilen ein Bild entsteht.
IDEEN MUSS MAN HABEN, hatte Plotzner gesagt, IDEEN SIND DAS WICHTIGSTE IN DIESER ZEIT.
Ein Vater ging mit seinem Sohn durch den Bayrischen Wald bei Kraiburg, die beiden gingen ein Flüßchen entlang, der Sohn blieb stehen und hob aus dem seichten Uferwasser eine Muschel heraus. Die Muschel schillerte an der Innenseite, außen war sie grau, das Tier hatte sein Gehäuse schon verlassen, die Schale lag halbrund und fest in der Hand des Buben, ein schöner, unbeschädigter Gegenstand inmitten der Zerstörungen, welche der Krieg und hier im Wald auch die Nachkriegsaktivitäten der Besatzungsmacht angerichtet hatten.
Was kann man daraus machen, fragte der Sohn.
Der Vater nahm die Muschel aus seiner Hand, wendete sie hin und her und betrachtete sie. Vielleicht Knöpfe, sagte er.
Er hatte mit Knöpfen bis dahin nur soweit zu tun gehabt, als er sie zum Verschließen seiner Kleidung benötigte, aber jetzt, beim Betrachten der Muschel, kam ihm eine IDEE. Er versuchte sich in der Herstellung von Knöpfen aus Muscheln und aus Walnußschalen. Aus diesen kleinsten Anfängen entstand eine Knopffabrik.
WAS KANN MAN DARAUS MACHEN, das war eine der wichtigsten Formeln für jene, die aus den Baracken, den Holzverschlägen, den Viehställen und Scheunen kamen oder noch darin saßen, die sich auf die Suche nach einer Arbeitsmöglichkeit, nach den Anfängen einer neuen Existenz begaben. Aus alten Autoreifen wurden Schuhsohlen, aus Konservenbüchsen wurden Schmuck und Christbaumbehang, aus Eisenstückchen wurden Werkzeuge, aus Maschinentrümmern funktionierende Maschinen, aus geeigneten Holzstückchen wurden Trommelstöcke und Flöten. In der Geigenbauersiedlung Bubenreuth bei Erlangen bewahrt man eine Geige, die aus Barackentrümmern gefertigt worden ist. WAS KANN MAN DARAUS MACHEN, fragten sich jene Vertriebenen, die man in das Lager Pürten bei Kraiburg gebracht hatte, als sie im Mühlbacher Hart auf die Trümmer und Reste der nur zum Teil zerstörten Munitionsfabriken und Bunker jener Anlagen stießen, welche die Deutsche Sprengstoffchemie während des Krieges errichtet hatte. Der Bombenkrieg hatte die gut getarnten Anlagen nicht zerstört, aber die amerikanischen Besatzer hatten gesprengt und demontiert. Nur ein Teil der Baracken und Bunker war erhalten geblieben, dazwischen lagen die Trümmer, gewaltige Blöcke aus schwerstem Beton, aus denen rostige Eisenstangen gefährlich hervorragten, dazwischen wucherte der Wald. Sie dachten ARBEIT, als sie auf die Maschinenteile stießen, die noch verwendbar waren. Die in der Heimat Fabriken besessen hatten, dachten AUFBAU und PRODUKTION. Sie zogen aus den Lagern in den Wald, sie bezogen diejenigen der Bunker, die noch beziehbar waren, von den Betonwänden rann das Wasser, sie brachen in monatelanger Schwerstarbeit Fensteröffnungen in die Wände. Sie wohnten und arbeiteten unter elendsten Verhältnissen, sie rodeten und gruben wie einst ihre Vorfahren in den böhmischen Ländern, wie jene, die man gerufen hatte, um aus Urwäldern fruchtbare Äcker zu machen. Sie hatte man nicht gerufen, und ihre Not war größer als jene der Vorfahren je gewesen war, denn jene waren als Arbeitskräfte und Siedler willkommen gewesen, sie aber waren als unerwünschte Eindringlinge gekommen. Immer wieder wurde, während sie bauten, demontiert und gesprengt, aber sie ließen sich nicht vertreiben, sie waren zäh, sie krallten sich fest an diesem Stück Waldgelände, sie hatten nichts zu essen und nichts, das sie hätten gegen Eßbares eintauschen können, sie bastelten Wäscheklammern aus Holzstückchen, die sie im Wald auflasen, und liefen damit zu den Bauern, um ein wenig Milch für die Kinder zu bekommen, jeder rostige Nagel, jeder Stoffetzen, jedes verwertbare Holzstück waren wertvolle Funde für sie. Buchstäblich aus dem Müll gruben sie die Anfänge ihrer Existenz.
Was hätten diese Leute aus dem Müll unserer Tage gemacht, sagt Bernhard, diese Frage drängt sich einem ja auf, wenn man das liest.
Ich, Anna F., bin auf der Suche nach Anfängen, die sich rund um den eigenen Anfang begeben haben, in die meine Anfänge eingebettet sind. Ich fühle mich als Einzelperson eingebunden in ein Geflecht verschiedenster sozialer und menschlicher Abläufe, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgespult haben wie Fäden und die jene Menschengruppe betreffen, der ich nach Herkunft und Schicksal zuzuzählen bin. Ich gehe herum und sammle die Fäden, wo ich sie finden kann, ich verfolge sie zu den Anfängen zurück. Ich lasse mir Geschichten erzählen, fahre mit dem Wagen durch Gegenden, in denen ich nie vorher gewesen bin, und sammle Landschaften, in die es die Menschen meiner Heimat verschlagen hat, ich lasse mir Bilder zeigen, alte Schwarzweißfotografien, die aus diesen Anfängen stammen und aus denen die Veränderungen erkennbar werden, die vorgegangen sind. Ich will, indem ich dies tue, eine Verbindung herstellen zwischen Früher und Jetzt, vielleicht eine Art Band flechten aus den gesammelten Fäden, das Halt gibt und zusammenhält. Ich weiß, indem ich darüber nachdenke, daß diese Vorstellung einer Art Wunschdenken entspringt, das eigentlich jeder realen Basis entbehrt, ebenso wie die ebenfalls mögliche Vorstellung, aus den gesammelten Fäden ließe sich etwas spinnen wie ein Kokon, dessen Inneres Schutz und Geborgenheit bieten kann. Beides, das unzerreißbare Band wie auch der Kokon, gehören in den Bereich der Illusion.
Wen oder was also will ich retten, wen oder was will ich bergen oder zu bewahren versuchen?
Laß die Vergangenheit, hätte Judith gesagt, was geht sie uns an. Wir leben HEUTE, und wir haben nur dieses eine Leben.
Ich aber weiß, daß spätere Entwicklungen ohne die Anfänge nicht vorstellbar sind.
Die ersten der Vorfahren, von denen wir wissen, sagte der Vater, sind aus dem Adlergebirge gekommen.
Einer der Fäden, die ich zu den Anfängen zurückverfolgt habe, führt in die Stadt zurück, die auf dem Bunkergelände bei Kraiburg entstanden ist und die man Waldkraiburg genannt hat. Sie ist vielen Adlergebirglern zur zweiten Heimat geworden.
Читать дальше