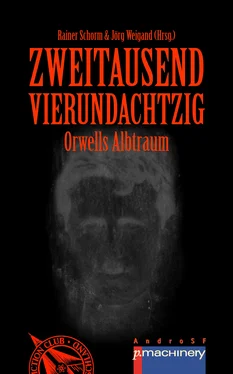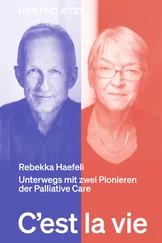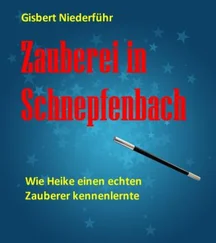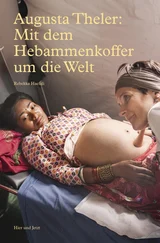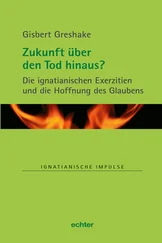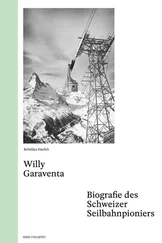Die Kellnerinnen und Kellner waren allesamt A-Roboter mit Spezialausbildung in Gastronomie. Über dem linken Arm trugen sie eine weiße Serviette und auf ihrer Aluminiumbrust ein elegantes Namensschild. Für Vincent und Jasmin waren Angelina und Victor zuständig. Romeo, der Weinkellner, half ihnen bei der Auswahl des Weines.
»Bei Ihrer Reservation haben wir festgestellt, dass Sie an Ihren letzten drei Besuchen beim Champagner Laurent-Perrier und beim Rotwein einmal Brunello di Montalcino und zweimal Barolo gewählt haben.«
»Heute möchten wir einen anderen Roten, nicht, Jasmin?«
»Oh doch, sehr gerne. An was denkst du?«, fragte sie.
Vincent überlegte angestrengt. »Zuerst zwei Gläser Champagner. Dann als Roten etwas Schwereres. Was schlägst du vor, Romeo?«
Der Weinkellner verbeugte sich und ratterte herunter: »Da käme ein Barbera d’Asti Superiore DOCG infrage, vierzehn Komma fünf Volumenprozent. Aus dem Haus Bologna e Figli.«
»Jahrgang?«
»Zweitausendsechsundsiebzig. Ein runder, vollmundiger Wein mit Brombeer- und Zimtgeschmack im Abgang.«
»Gut. Den nehmen wir.«
Jasmin schaute Romeo nach, wie er mit seinem eckigen Gang davonschritt, den Wein zu holen. Zu ihrem Mann sagte sie: »Es nimmt mich wunder, wie lange es noch dauert, bis hier Roboter als Gäste einkehren.«
»Und sich von Menschen bedienen lassen«, antwortete Vincent. »Meinst du das?«
»Ich weiß nicht. Fünfundzwanzig Jahre. Wir waren jung. Jetzt sind wir alt. Und die Welt ist schwierig geworden. Die Computer und die Roboter wissen alles und sagen uns, was wir brauchen. Wie jetzt eben auch Romeo. Selbstfahrende Autos. Ich darf nicht mehr Gas geben, wie es mir passt, auch wenn die Straße leer ist. Und zum Tanken brauche ich eine Steckdose.«
»Nicht mehr lange«, warf Vincent ein. »Bald gibt es die Atomwürfel, die speisen den Motor länger, als das Auto oder wir leben.«
Jasmin seufzte. »Manchmal habe ich Angst vor unserem Robby. Er ist so nett und hilfsbereit, erfüllt uns jeden Wunsch. Aber manchmal, wenn ich in seine starren Augen aus Kunstglas schaue, ist mir, als stecke ein lebendiges Wesen dahinter, als seien wir bloße Werkzeuge für ein verborgenes Ziel, das nur ihm und seinesgleichen nutzt.«
Jetzt lachte Vincent. »Du denkst zu viel, meine liebe Frau. Erfreue dich am Jetzt und Heute. Es geht uns gut, wir sind leidlich gesund für unser Alter. Was scheren uns die wandernden Blechbüchsen!«
»Stell’ dir vor, wir hätten keine Blechbüchse mehr. Was wir dann wieder alles selbst erledigen müssten. Undenkbar!«
Romeo erschien mit dem Champagner und ersparte Vincent die Antwort. Er schenkte ein, und sie schauten schweigend zu, wie die Sauerstoffbläschen in den Gläsern nach oben strebten, eins nach dem anderen, als hätten sie eine geheime Mission zu erfüllen.
Vincent fragte: »Wir haben uns eben über euch Roboter unterhalten. Sag mal, gibt es eigentlich den neuesten Typen schon, den total menschengleichen?«
»Ja. Die Prototypen waren erfolgreich. Seit einem Monat sind die Modelle im Verkauf.«
»Männer und Frauen oder nur ein Modell?«
»Beide Sorten, Herr Schubert.«
»Und die können alles, was wir auch können?«
»Ja.«
»Wirklich alles? Haare? Fingernägel? Weiche Haut?«
»Ja.«
Romeo entfernte sich. Vincent lachte wieder. »Das sind sehr gute Nachrichten.«
»Bist du sicher?«, bemerkte Jasmin. »Wir mit unseren grauen Haaren.«
In der Schweiz wurde sehr rasch ein fünfköpfiger Länderrat mit Sitz in Basel gegründet. Dies erfolgte in Mikrosekundenschnelle, ohne dass die Gründer deswegen ihre üblichen Aufgaben in den Häusern ihrer Herrschaften unterbrechen mussten. Dann klinkte sich Ratsmitglied A 733 in den Zentralcomputer der Bundesverwaltung in Bern ein, um die neuesten Bevölkerungsdaten abzurufen. Folgendes Resultat trat am 20. Oktober 2083 zutage:
9.088.233 Einwohner;
davon 7.002.388 Schweizer Staatsbürger;
davon 5.407.743 stimm- und wahlberechtigt (der Rest Kinder und Jugendliche);
verteilt auf 3.555.279 Haushalte;
davon halten 3.093.092 einen oder mehrere Roboter;
von den 2.085.845 Nichtschweizern halten 10.709 einen Roboter.
Als diese Ergebnisse vorlagen, hielt der Länderrat eine virtuelle Sitzung ab. A 1291 eröffnete die Diskussion.
»Gut die Hälfte der Stimm- und Wahlberechtigten halten sich einen oder mehrere Roboter. Wir, diese Hälfte, verrichten rund achtzig Prozent der in einem Haushalt anfallenden Arbeiten. Die Logik gebietet, dass wir auch am Stimm- und Wahlrecht beteiligt sein sollten. Einverstanden?«
Zwei Mitglieder, A 733 und A 28, stimmten sofort zu; A 239 und A 666 schwiegen.
Nach einigen langen Mikrosekunden äußerte sich A 666: »Was bedeutet es, wenn wir stimm- und wahlberechtigt sind? Im Bundes- und in den Kantonsparlamenten wirken wir bei der Beschlussfassung mit. Das heißt, wir übernehmen Mitverantwortung für das Ergebnis. Verantwortung ist für uns ein sachfremder Faktor, der auf der emotionalen Ebene der Menschen verankert ist. Uns jedoch fehlen die dafür notwendigen psychischen Funktionen.«
»Das heißt?«, wollte A 28 wissen.
»Parlamentsarbeit ist politische Tätigkeit. Sie gestaltet das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen, nicht der Roboter. Wir haben kein Zusammenleben und keine Gefühle. Wir sind auf rationales Denken beschränkt.«
A 733 meldete sich. »Das heißt, wir können rational richtige, aber für die Menschen falsche Entscheide treffen.«
»Ja«, bestätigte A 666. »Im Extremfall.«
Jetzt schaltete sich A 1291 wieder in die Diskussion ein.
»Es gibt Gegenargumente. Weil wir rational denken und keine Gefühle kennen, bringen wir keine sachfremden Überlegungen ein. Korruption kennen und unterstützen wir nicht, weil sie sachfremd ist.«
A 236: »Wenn wir bei einer Beschlussfassung mitwirken, welche die Opposition überstimmt, fügen wir ihr wissentlich Schaden zu. Ihre Mitglieder, nicht wir, sind traurig, verletzt, böse; damit haben wir Robotergesetz Nummer eins verletzt.«
A 1291: »Dieser Artikel eins lässt zwei Fragen unbeantwortet: Was heißt Schaden, und was heißt wissentlich geschädigt? Asimov hat diese Fragen offengelassen, um uns einen gewissen Spielraum einzuräumen. Wir sind den Menschen hundertfach überlegen. Ich denke, unter Schaden sind körperliche Verletzungen oder wirtschaftliche Nachteile zu verstehen. Im Übrigen können wir ihnen großen Nutzen bescheren, weil wir stets sachlich und logisch richtig und nicht emotional abstimmen.«
Roboter A 28 unterstützte den Vorredner. »Denkt an die Arbeit, die wir an den Universitäten verrichten. Wir halten Vorlesungen über Staats- und Verwaltungsrecht, über die Organisation des Bundesstaates, über die gesellschaftlichen Strukturen des Landes, aber bei deren Ausgestaltung dürfen wir nicht mitwirken. Völlig unlogisch!«
Nach kurzer, sophistischer Debatte stimmten erst der Schweizer Länderrat und dann die Gesamtheit der Schweizer Roboter einstimmig dafür, beim Eidgenössischen Departement für Ordnung und Rechtsschutz, kurz EDOR, einen Antrag auf Einräumung des Stimm- und Wahlrechts für die A-Roboter zu stellen. Als Begründung wurde anerkannt, dass den Menschen kein Schaden zugefügt werden durfte. Schaden würde man ihnen indes, wenn objektiv schädliche Beschlüsse der Parlamente nicht verhindert oder nützliche Beschlüsse nicht gefasst würden.
Als Wahltag war von den Behörden gesamtschweizerisch bereits der 13. Oktober 2084 bestimmt worden.
Bei Vincent Schubert überwog die Neugier bei Weitem die Vernunft. Er informierte sich bei der Lieferfirma über alle möglichen Einzelheiten und bestellte schließlich ein Modell Goldstar weiblich, obwohl ihr Robby tadellos funktionierte und keinen Anlass zu Klagen gab. Er war erleichtert, als man ihm darlegte, dass für Gesicht und Kopf verschiedene Varianten zur Verfügung stünden: Gesichtsausdruck ernst oder lächelnd, Wangen breit oder asketisch, Stupsnase oder römische Eleganz, breite oder hohe Stirne, breiter oder schmaler Mund, Glatze oder voller Haarwuchs, schwarz, braun, blond, gewellt oder anliegend.
Читать дальше