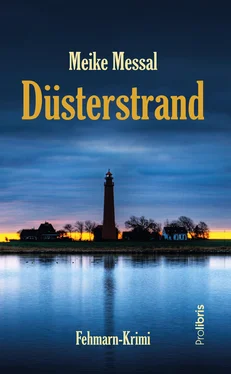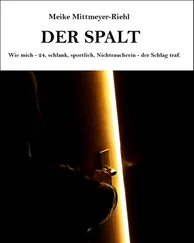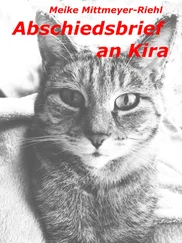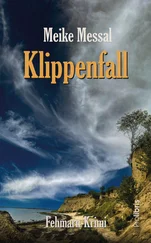Dann der Schrecken in ihrem Blick, als der Wagen plötzlich schleuderte, ihr Aufschrei. Die tiefe Stimme ihres Vaters, die irgendetwas rief. Laura verstand ihn nicht, alles drehte sich, knirschte, quietschte, Mutters Stimme, die immer noch schrie. Und dieser Knall, dieser entsetzliche Knall. Der Schmerz, als Laura in den Gurt gedrückt wurde, der Ruck, der sich anfühlte, als würde ihr Körper durchtrennt. Etwas rieselte in ihr Gesicht, es tat weh, alles tat weh.
Als sie die Augen öffnete, war da nur Nebel und so ein komisches Geräusch, es fiepte in ihren Ohren, laut und anhaltend. Laura versuchte, etwas zu erkennen, aber überall war Glas, und ihre Mutter lächelte nicht mehr. Ihr Kopf war seltsam verdreht, Blut sickerte über ihr Haar, lief an ihrer Wange hinunter, tropfte auf den Sitz, der voller Glasscherben war. Ein Ast ragte in das Auto, seitlich durch das Fenster. Und vorne dieser riesige Baum. Stoisch stand er da, ihn störte der Wagen nicht, der halb um ihn gewickelt war, er war immun gegen den Schmerz. Ihren Vater konnte sie nicht erkennen. Aber sie nahm keine Bewegung wahr. Auch nicht, als sie ihn rief. Als sie schrie. Sie schrie, schrie immer noch, als die Feuerwehr sie aus dem Wagen holte, schrie und schrie. Denn Mama und Paps bewegten sich nicht mehr, sagten nichts. Sie blieben einfach stumm.
18
Der Raum war klein und von oben bis unten gekachelt. Weiße Kacheln überall, die im Licht der langen Lampen unter der Decke böse glitzerten. An der rechten Seite erkannte er eine alte Badewanne. An einigen Stellen war das Weiße abgeplatzt. Rechts hing ein kleines Waschbecken an der Wand, ein Stück war aus den Fugen gerissen, sodass die linke Seite seltsam verdreht nach unten zeigte.
Inzwischen hatte der Durst den Hunger abgelöst. In seinem Kerker hatte er wenigstens immer eine Kanne mit Wasser gehabt. Er warf einen erneuten zaghaften Blick auf das Waschbecken. Würde daraus Wasser kommen? Es sah nicht wirklich so aus, als wäre es noch in Ordnung. Und die Wanne? Ihm blieb keine Zeit drüber nachzudenken, denn der Mönch hatte ihn schon in den Raum gezerrt und vor die Badewanne gestoßen. Nun sah er, dass sich darin etwas befand. Kein Wasser. Er zog die Augenbrauen zusammen und starrte auf die weißen Stückchen. Was war das bloß?
»Zieh die Hose aus!« Wie immer war die Stimme des Mönches schneidend wie ein eiskalter Winterwind.
Er blickte auf seine Jeans hinunter. Sie starrte vor Schmutz, die ehemals blaue Farbe hatte sich zu einem breiigen Braun-Grün gewandelt. Trotzdem wollte er sich nicht von ihr trennen. Mit einem Mal kam ihm diese Hose wie das Kostbarste vor, das er hatte. Sein einziger Schutz.
Der Mönch legte seine Fingerspitzen aneinander. »Das ist das letzte Mal, dass ich dir die Regeln erkläre«, sagte er. »Die oberste Regel ist – du gehorchst. Nichts ist wichtiger als das. Ich will dir nicht wehtun. Wenn du gehorchst, wird alles gut. Wenn nicht, brockst du dir ganz schöne Schwierigkeiten ein.«
Einen Moment zögerte er, dann zog er langsam die Jeans herunter. Zum Glück hatte er noch seine Unterhose an. Die mit Spiderman drauf, seine Lieblingsunterhose. Der Anblick seines Superheldens gab ihm neue Kraft. Er hob die Hose auf.
»Gut so.« Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, so etwas wie Milde in dem Mönch zu erkennen. »Nun lege sie ordentlich zusammen.«
Kritisch beäugte der Mönch seine Versuche, gab ihm Anweisungen. Ganz genau gefaltet musste sie sein, Hosenbein auf Hosenbein, glattgestrichen. Endlich war der Mönch zufrieden. Die vor Dreck starrende Hose lag so ordentlich zusammengelegt auf dem Wannenrand, als hätte Mama sie gerade frisch gebügelt.
»Jetzt steig in die Wanne!«
Das bisschen Wärme, das er eben glaubte, wahrgenommen zu haben, war wieder verschwunden. Vorsichtig berührte er mit dem Fuß die weiße Schicht. Kleine Körner blieben an seiner Ferse haften. Stirnrunzelnd blickte er darauf. Das war doch Reis!
»Das ist ungekochter Reis«, erklärte der Mönch nun, als ob er es doch selbst gesehen hätte. »Knie dich hin! Der Po bleibt oben, nicht auf die Fersen setzen!«
Er ließ sich auf den Reis sinken. Sofort bohrten sich die kleinen Körner in seine nackten Knie. Er biss sich auf die Lippen. Gut, das war nicht schön. Aber es war auch nicht furchtbar. Wenn das seine Strafe war, dann hatte er Glück gehabt.
Mit gesenktem Kopf kniete er in der Wanne voller Reis.
»Du bleibst genau so, in dieser Haltung, und denkst über dein Verhalten nach. Wenn du das schaffst, darfst du nachher wieder essen und trinken. Wenn nicht, dann bringe ich dich in den nächsten Raum. Und glaube mir, da ist es noch schlimmer als hier!« Mit diesen Worten verließ der Mönch das Bad, die Tür fiel quietschend hinter ihm ins Schloss.
Vorsichtig hob er den Kopf. Das Waschbecken! Ob er kurz hinüberschleichen und etwas trinken könnte? Vielleicht funktionierte es ja! Seine schlimmen Krämpfe hatten nachgelassen, aber noch immer rumorte es in seinem Bauch. Und er hatte so fürchterlichen Durst!
Außerdem fingen seine Knie an, wehzutun. Die Reiskörner bohrten sich wie kleine Nadeln in seine Haut. Er verlagerte das Gewicht und stöhnte vor Schmerzen auf, als neue Stiche in seinen Körper schossen.
Abermals lugte er zum Waschbecken hinüber. Da sah er es aus dem Augenwinkel. Ein Blinken, rot. Es kam aus der oberen rechten Ecke des Raumes. Seine Augen wanderten die Wand entlang und blieben an der kleinen Kamera haften, die an der Decke angebracht war und genau auf ihn zeigte. Er stöhnte auf. Hatte es die auch in seinem Gefängnis gegeben? Hatte der Mönch ihn die ganze Zeit beobachtet? Er hatte solche Angst und solchen Hunger gehabt, dass er gar nicht darauf geachtet hatte.
Also kein Wasser. Er würde ausharren müssen. Diesmal würde er es schaffen. Es gibt zu essen und zu trinken, hatte der Mönch gesagt. Er musste nur durchhalten.
Mit einem tiefen Atemzug verlagert er erneut sein Gewicht. Vorsichtig. Und schrie auf. Denn inzwischen fühlten sich die Reiskörner nicht mehr wie Reiskörner an. Sie stachen in seine Haut, setzten sich fest. Kleine, unzählige Glassplitter, die ihn aufschnitten. Er spürte jedes einzelne von ihnen und die Wunden, die sie in seinen Körper ritzten.
19
Nele starrte Wiebke und Laura an, die bei ihr auf dem Sofa saßen. Unter anderen Umständen sah sie bestimmt sehr hübsch aus. Sie war zierlich und schlank, fast zerbrechlich, ihre kurzen dunklen Haare rahmten ein blasses Gesicht ein. Zu bleich war das allerdings und die Augen waren rotunterlaufen. Sie trug einen alten Jogginganzug, der ihr zu groß war und um sie herumschlotterte. Laura hätte sie am liebsten in den Arm genommen, aber Neles Blick sah abweisend aus.
»Wir wollen wirklich nur helfen«, sagte Wiebke zum wiederholten Male. »Du musst schon zugeben, irgendwie ist es merkwürdig, dass drei Jungen in dem gleichen Alter auf Fehmarn verschwinden.«
»Bei den letzten beiden ist es aber zehn Jahre her.« Neles Stimme war schrill. »Zehn verdammte Jahre.« Sie griff nach einem Taschentuch, das in ihrem Hosenbund steckte, und putzte sich die Nase. »Tom ist bestimmt einfach nur weggelaufen. Diese ganze Sache mit seinem Diabetes, das war zu viel für ihn. Er hat die Krankheit geleugnet, so getan, als sei er nicht erkrankt.«
Eindringlich schaute Wiebke ihre Schwiegertochter an. »Du hast sicher Recht, aber er braucht trotzdem Hilfe. Ohne Insulin ist es unmöglich für ihn, zu überleben. Wir müssen ihn finden, Nele!«
Nele zog die Nase hoch. »Ich weiß, ich weiß«, rief sie. »Was glaubst du denn, was wir hier machen? Die Polizei sucht nach ihm, setzen Hubschrauber ein, Wärmebildkameras, Hunde, alles. Und Thorben und ich sind abwechselnd unterwegs, fahren all seine Lieblingsplätze ab. Die Spielplätze, das Meereszentrum, den Strand, das U-Boot. Aber einer von uns muss immer hier sein, falls er … falls er wiederkommt.«
Читать дальше