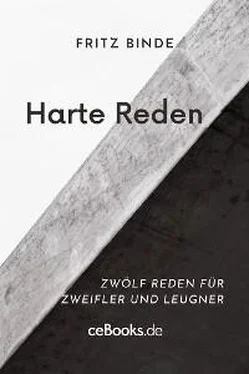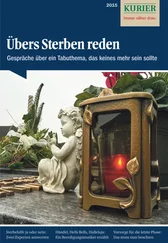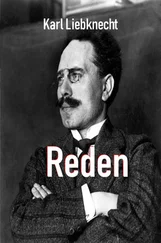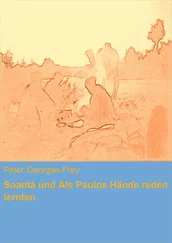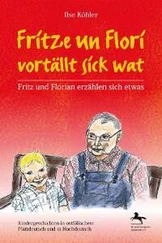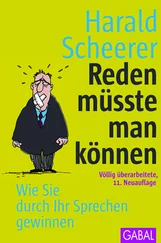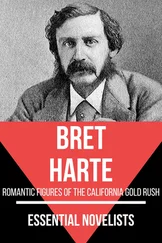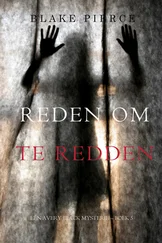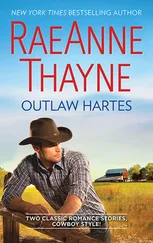Es bleibt also dabei: Nur wer aufgrund der Offenbarung Gottes im heiligen Schriftworte durch erlebten Glauben klar weiß, wozu und für wen er lebt und arbeitet, der schätzt die Arbeit recht ein und tut sie oder legt sie nieder getröstet. Ohne solchen wissenden Glauben bleibt auch das heute so beliebte Carlylesche 2Wort: „Arbeiten und nicht verzweifeln!“ nur eine schillernde Kulturphrase und der großtuerische Ausdruck bereits eingetretener platter Verzweiflung. Wäre die Arbeit anders ein Trost und schützte sie anders vor Verzweiflung – in welcher trostreichen, erquickenden Gegenwart müssten wir dann leben; denn zu keiner Zeit ist so intensiv gearbeitet worden wie heute. Entweder kehrt unsere wirre, überarbeitete Zeit zum Glauben zurück – oder ihr Siegel heißt: „Hoffnungslos!“
Und so ist es auch mit dem dritten Moralsätzlein:
„Der einzige Genuss – die Schönheit.“
Erziehung zur Kunst ist ein modernes Schlagwort geworden. Der künstlerisch schaffende und der künstlerisch genießende Mensch gelten als die eigentlichen Kulturträger. Von keiner Bemühung verspricht man sich so viel Veredelung des Menschen, wie von der Heranbildung der Sinne zum Kunstverständnis. Natur- und Kulturoffenbarungen sollen da gewonnen werden, wie man sie nie zuvor gekannt habe. Ein neuer Mensch werde der Erde gegeben: der ästhetische Mensch, der die Religion des Schaffenden bringe, den erlösenden Dienst und Genuss der Kunst. – Dieses Kulturideal hat reichlich Anhänger gefunden, denn es entspricht der sinnlichen Anlage des Menschen. Sinnenpflege im Interesse der Kunst, Kunstbetätigung und Kunstliebe als Vorzugskultur, Kunstverständnis als Ausweis wertvollster Höchstreife inmitten einer Zeit, die von dem Zauberwort „Entwicklung“ berauscht ist, o, das ist etwas für den immer genießenwollenden Menschen, der an die Welt der Sichtbarkeit und an sich selbst versklavt ist! So ist denn vielen „Gebildeten“ die Kunst einfach zur Religion geworden. Sie betrachten jetzt reichlich alles vom sogenannten künstlerischen Standpunkt aus, den sie natürlich möglichst „jenseits von Gut und Böse“ gewählt haben, und der ihnen erlaubt, alles genießend zu erleben und sich zugleich an nichts sittlich zu binden. So genießt man sogar in ästhetischer Überlegenheit das künstlerisch veranschaulichte oder vertonte Leiden Jesu Christi. Man sucht eben grundsätzlich längst nicht mehr ernste, unwidersprechliche, unabweisbar verpflichtende Wahrheit, sondern nur noch irgendwie genießbare Schönheit, in der sich, wie man gerne sagt, das „Göttliche“ am reinsten und annehmbarsten offenbare.
Man muss es mutig aussprechen: Das Ergebnis der ästhetischen Erziehung zum Genuss der Schönheit ist zum allergrößten Teil nichts anderes, als gesteigerte Sinnenlust, Erhöhung der selbstsüchtigen Ansprüche auf Ausstattung und Bequemlichkeit, üppigere Entfaltung der Modetorheiten, unbedenklichere, raffiniertere Genusssucht in Essen und Trinken, zugleich moralische Erschlaffung auf der ganzen Linie, Verlust an Einfachheit und Keuschheit, Zunahme der eitlen Selbstherrlichkeit, unfruchtbare Genusssucht bis ins Sensationell-Religiöse hinein, an Stelle der herben Wahrheit des einfachen Evangeliums pantheistisch-monistische Gedankenspielerei, Berauschung an spiritistischen, theosophischen und okkultistischen Ungeheuerlichkeiten, und durchaus Verlust an christlicher Wahrheit, Echtheit und Klarheit.
Und was wird der eigentliche Offenbarungswert der gegenwärtigen künstlerischen Überproduktion sein? O, er wird äußerst gering sein! Gemäß unserer ganzen Zeitentwicklung wird er bestehen in viel Technik und in wenig Gedanken. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Auch das Kunstschaffen kann nur in Verbindung mit dem lebendigen persönlichen Gott und seinem Gesalbten Jesus Christus zu klarer und großer Reife gedeihen. Wo man aber bewusst ohne Gott zu leben und zu schaffen begehrt, da wuchert zuletzt nur noch die eitle menschliche Mache mit allen ihren widerspruchsvollen Albernheiten, wie es heutzutage in der Kunst zutage tritt. Aber selbst die reifste Kunst kann kein Volk vor seinem Niedergang retten; sie ist Blüte, aber nicht Wurzel. Deswegen kann sie nie zur Erklärung und Erlösung unseres Lebens dienen. Die Kunst vermag uns im besten Falle ein erhebendes Ahnen des Göttlichen, für das wir bestimmt sind, verschaffen, aber bleibend und erlösend herausheben aus der gemeinen bändigenden Macht unserer fluchbeladenen Lebensverhältnisse, das vermag kein Kunstschaffen und kein Kunstgenuss. Gerade die größten Künstler haben das einsehen und am Erlösungswert der Kunst verzweifeln müssen. Michelangelo, vielleicht der größte Bildhauer und Maler, musste dichten:
„Am Ziel der Fahrt ist angelangt mein Leben,
Auf schwachem Kahn durch wilden Meers Gewalten,
Im Hafen, wo der Landende gehalten
Ist, Rechnung über all sein Tun zu geben.
Die mich die Kunst zur Gottheit ließ erheben,
Zum einz'gen Herrn, die Freude am Gestalten:
jetzt weiß ich, wieviel Irrtum sie enthalten;
Denn Irrtum ist des Menschen Erdenstreben.
Was gilt, was einst ich sann in Lust und Fehle,
Wenn zwiefach Sterben mir vor Augen schreitet,
Ein Tod gewiss, der andre schreckt mit Bangen?
Nicht mal' noch meißl' ich mehr, Ruh wird der Seele
Von jener Gottesliebe nur, die breitetAm Kreuz die Arme aus, uns zu umfangen.“
Also auch hier bei allem Dienst der Schönheit, ohne den biblischen Glauben, nichts anderes als Hoffnungslosigkeit!
Nicht Pflicht als Glück, nicht Arbeit als Trost, nicht Schönheit als Genuss beantworten die bange Frage des Menschen nach dem Wozu? seines Daseins. Mithin ist alles Tun und Genießen des Menschen ohne den lebendigen biblischen Glauben hoffnungslos!
Das soll uns noch deutlicher werden, wenn wir jetzt zum Schluss noch die letzte Frage betrachten, die Frage nach dem Wohin?
Wohin Mensch, Menschheit, Menschenwerk und die vom Menschen wahrgenommene Welt?
Bei dem Versuche, diese allerwichtigste, allerhöchste Frage zu beantworten, zeigt sich die Hoffnungslosigkeit des Unglaubens am auffälligsten. Wie lautet die Antwort, die er uns anbietet? Sie lautet kurz zusammengefasst so: Vom Menschen zurück zum Nebelfleck.
Vor mir liegt eine Einladung zu einem naturwissenschaftlichen Vortrag, betitelt: „Die Tragödie der Erde“, das will sagen: „Die Unglücksgeschichte der Erde“, gemäß folgendem Programm:
I. Teil.
Wie konnte die Erde im Weltenraum entstehen?
Wie entwickelten sich die ersten Lebewesen auf der Erde?
Wie bildete sich der Mensch aus den niedrigsten Formen der Lebewesen?
Das erste Auftreten des Menschen.
Halbmensch, Vormensch, Urmensch.
II. Teil.
Die Entwicklung des Menschen und seiner Kultur.
Der Mensch der Zukunft.
Die höchste Stufe der Kultur auf Erden.
Rückgang und Verfall des Lebens auf der Erde.
Uns möge jetzt der zweite Teil dieser „Unglücksgeschichte der Erde“ interessieren. Da wird uns zunächst wissenschaftlich verkündigt, es gehe mit dem Menschen und seiner Kultur noch immer mächtig vorwärts. Ungeahntes werde sich erfüllen. Doch habe sich der Mensch nicht herausgerungen aus seiner tierischen Herkunft und Vergangenheit. Noch lebe die Bestie in ihm. Aber die Überwindung des Tierischen sei nur eine Frage der Zeit. Allerdings könne diese Zeit Jahrhunderttausende umfassen. Das sei aber im Vergleich mit der Länge der Entwicklungsperiode, die die Umwandlung des Wirbeltieres zum Kulturmenschen umfasse, so gut wie gar nichts. Also nur Geduld. Gerade gegenwärtig tue die Kulturmenschheit in Naturerkenntnis und Naturbeherrschung wieder einen ganz gewaltigen Schritt vorwärts, der zum Glauben an die Erreichung der höchsten Kulturideale berechtige. Der Mensch der Zukunft werde sich als völliger Herr der Natur erweisen. Keine Phantasie könne sich die Herrlichkeit dieser Herrschaft ausmalen. Ihr werde die Gerechtigkeit, Freiheit und Vernünftigkeit seiner ethischen und sozialen Kultur entsprechen, die ihm eine Zeit vollkommenen Wohlbefindens als Lohn für alles menschliche Ringen auf seiner Erde bringen werde. Aber inmitten des ewigen Werdens und Vergehens könne ja auch diese sicher zu erwartende höchste Kultur nicht von bleibender Dauer sein.
Читать дальше