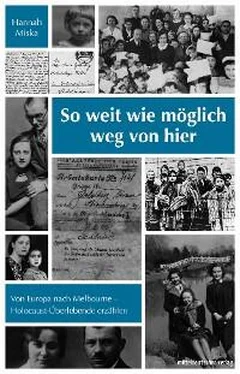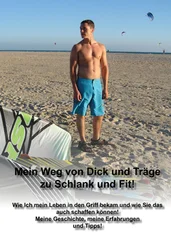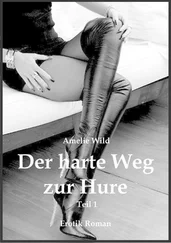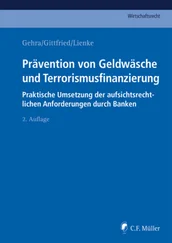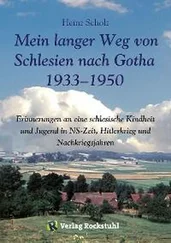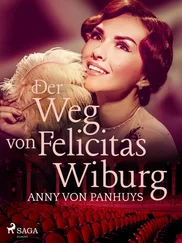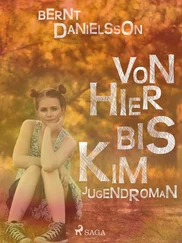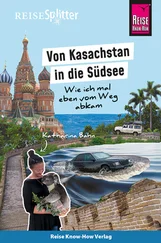1 ...6 7 8 10 11 12 ...23 Klemperer merkt an: „Ich glaube, diese 31 Punkte sind alles. Sie sind aber alle zusammen gar nichts gegen die ständige Gefahr der Haussuchung, der Misshandlung, des Gefängnisses, Konzentrationslagers und gewaltsamen Todes.“
Im November 1939 wird Irmgards Mutter Rosa verhaftet.
„Ich kam wie immer von der Schule nach Hause, und meine Mutter war nicht da. Ich spielte also mit den Nachbarskindern, aber Stunde um Stunde verging, und meine Mutter kam immer noch nicht. Nach zwei Tagen kam dann meine Tante Lotti – ich weiß nicht, ob die Nachbarn sie informiert haben oder wieso sie kam.“
Das Gespräch stockt, Irmgard kann sich an keinerlei Einzelheiten erinnern – wie sie die zwei Tage verbrachte, wie die Zeit herumging. Das Einzige, woran sie sich erinnert und was sie heute noch fühlt, ist diese unsägliche Traurigkeit.
„Meine Tante hat mir erzählt, dass sie mich in einer Küchenecke sitzend gefunden hat. Dort saß ich und weinte. Nicht mal daran kann ich mich erinnern. Ich muss meine Gefühle wohl völlig betäubt haben. Ich weiß nur noch, dass ich mich elend verlassen fühlte – verlassen von meiner Mutter. Warum bloß hatte meine Mutter mich verlassen?“
Lotte Hempel nimmt ihre Nichte mit zu sich nach Hause und wendet sich aufgebracht an die Dresdner Staatspolizeidienststelle.
„Meine Tante ist gleich zur Gestapo gegangen, um herauszufinden, was mit meiner Mutter passiert ist. Sie hat natürlich nichts erreicht und nur erfahren, dass meine Mutter verhaftet worden sei.“
Walter Hempel, der inzwischen zur Wehrmacht gezogen wurde, wird aufgefordert, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen. Als er nicht Folge leistet, wird er aus der Wehrmacht entlassen und zu Zwangsarbeit verpflichtet.
„Auch meine Tante wurde zur Zwangsarbeit herangezogen. Sie haben beide bei Zeiss Ikon gearbeitet, das war eine bedeutende Kamerafirma, die in ein Rüstungsunternehmen umfunktioniert worden war und nun Zeitzünder und Bombenzielanlagen produzierte. Als Nächstes wurden mein Onkel und meine Tante dann aus ihrer Wohnung geschmissen, sie mussten in eine sehr arme Gegend Dresdens ziehen, die Wohnung lag über einer Konservenfabrik. Diese Fabrik beschäftigte eine Menge Zwangsarbeiter aus Polen, Russland, der Ukraine und aus Litauen. Jeden Abend um sieben klopfte es an der Tür – das war die Gestapo, die kontrollierten, ob Tante Lotti und Onkel Walter zu Hause waren.“
Die vermutlich demütigendste antijüdische Verordnung wird am 1. September 1941 erlassen – die Polizeiverordnung zum Tragen eines Judensterns. Mit Wirkung vom 19. September müssen alle Juden des Großdeutschen Reiches und des Protektorats Böhmen und Mähren, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, einen Judenstern tragen. In der Mitte des handtellergroßen gelben sechszackigen Sterns steht – in einer seltsam gebogenen Schrift, die hebräisch anmuten soll – das Wort „Jude“. Der Stern muss bei der jeweiligen Gemeinde gegen die Zahlung von zehn Pfennig und gegen Unterschrift einer Quittung abgeholt und auf die linke Brustseite der äußeren Kleidung aufgenäht werden.
„Ich habe den Stern gehasst. Auf meinem Weg zur Schule bin ich von anderen Kindern geschlagen worden, sie haben mich bespuckt und mich ‚verdammte Jüdin‘ genannt. Ich habe immer versucht, den Stern zu verstecken und habe meinen Schulranzen davor gehalten. Das war natürlich verboten.“
Für Erwachsene ist das Tragen des Judensterns gleichermaßen erniedrigend. Victor Klemperer geht am 19. September, nachdem seine Frau den Stern aufgenäht hat, nur im Schutze der Dunkelheit auf die Straße. Der Weg zum Kaufmann am nächsten Tag kostet ihn enorme Überwindung.
Nachdem der Besuch deutscher Schulen für jüdische Kinder bereits seit November 1938 verboten ist, wird die Reichsvereinigung der Juden im Juni 1942 angewiesen, alle jüdischen Schulen im Deutschen Reich zu schließen. Auch die jüdische Schule in Dresden wird geschlossen. Von nun an ist Irmgard tagsüber auf sich selbst angewiesen. Während Lotte und Walter Hempel bei Zeiss Ikon arbeiten, streunt Irmgard durch Dresden.
„Ich war ziemlich alleine und wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Meine Tante hat mich dann bei einer anderen jüdischen Familie untergebracht, aber die wurde verhaftet, und so war ich also wieder alleine. Meine Tante, die wahrscheinlich nicht wusste, was sie mit mir machen sollte, kaufte mir dann einen Frosch, der mir Gesellschaft leisten sollte. Er saß in einem kleinen Glas, und ich musste Fliegen für ihn fangen. Das hat mich jeden Tag eine Weile beschäftigt. Die restliche Zeit hab ich viele Bücher gelesen.“
Dass Lotte Hempel einen Frosch anstelle eines Hundes oder einer Katze kauft, hat seinen Grund: Per Verordnung ist es Juden und jedem, der mit ihnen zusammenwohnt, ab Mai 1942 verboten, Haustiere (Hunde, Katzen und Vögel) zu halten. Tiere, die bereits im Besitz von Juden sind, dürfen nicht in Pflege gegeben werden. Victor Klemperer berichtet, wie er und seine Frau den geliebten Kater Muschel beim Tierarzt töten lassen müssen.
Die Gestapo weist Lotte Hempel an, keinen Kontakt mit „arischen“ Bürgern zu halten.
„Mein Onkel und meine Tante hatten aber viele nicht jüdische Freunde, und sie sahen gar nicht ein, dass sie den Kontakt abbrechen sollten. Der Besitzer der Konservenfabrik, ein Nazi, denunzierte meine Tante dann. Daraufhin wurde sie zur Gestapo-Dienststelle bestellt, wo sie ein Papier unterzeichnen musste, dass sie in Zukunft nicht mehr mit ‚Ariern‘ verkehre. Nachdem sie sich wieder nicht daran hielt, wurde sie erneut denunziert und ein zweites Mal zur Gestapo zitiert. Dieses Mal ging mein Onkel mit. Da war ein SS-Mann namens Müller, der sagte zu meinem Onkel: ‚Wenn Ihre Frau meine Frau wäre, würde ich sie auch beschützen‘, und der tat dann so, als würde er das von meiner Tante unterschriebene Papier nicht finden. Er ließ sie gehen. Solche Leute gab es eben auch.“
Ende 1941 zählt die jüdische Gemeinde Dresdens noch 1.228 Mitglieder. Anfang 1942 finden die ersten „Evakuierungen“ der Dresdner Juden ins „Reichskommissariat Ostland“ statt – ein deutsches Verwaltungsgebiet, das das Baltikum und Teile Weißrusslands in der von den Deutschen besetzten Sowjetunion umfasst. Am 15. Januar werden 224 Dresdner Juden davon informiert, dass sie für einen Evakuierungs-Transport in wenigen Tagen bestimmt seien. Sie dürfen 50 kg Gepäck mitnehmen, nicht erlaubt sind Wertpapiere, Sparkassenbücher, Devisen, Gold oder Silber außer dem Ehering. 50 Reichsmark müssen für die Transportkosten bereitgehalten werden. Am 20. und 21. Januar werden die Dresdner Juden frühmorgens aus ihren Häusern geholt, zum Bahnhof Dresden-Neustadt gebracht und nach Riga transportiert. Ausgenommen von der Deportation sind zunächst noch in Mischehe lebende Juden sowie deren Kinder. Auch sogenannte „Altersjuden“ über fünfundsechzig sowie Juden, die im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden sind, stehen noch nicht auf den Transportlisten – sie sind für spätere Transporte nach Theresienstadt vorgesehen. Das Zeiss Ikon-Werk erreicht, dass die zwangsbeschäftigten jüdischen Mitarbeiter der Firma wegen vordringlicher Rüstungsproduktion zunächst von der Deportation zurückgestellt werden.
Im Juli beginnen die Deportationen der älteren Juden nach Theresienstadt, bis September gehen sieben Lkw-Transporte mit jeweils 50 Dresdner Bürgern in das „Altersghetto“ im Protektorat ab. Etliche Juden verüben Selbstmord, nachdem sie die Evakuierungs-Nachricht bekommen.
„Meine Großtante Sophie, die Schwester meines Großvaters, hat sich auch umgebracht. Sie lebte in Hamburg und war die Lieblingstante meiner Tante Lotti. Tante Lotti und Onkel Walter fuhren mit dem Tanzorchester oft nach Hamburg und wohnten dann bei ihr. Irgendwann erhielt jedenfalls auch Tante Sophie den Deportationsbescheid. Da war sie schon über achtzig – und schluckte Gift.“
Читать дальше