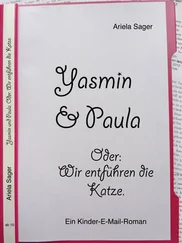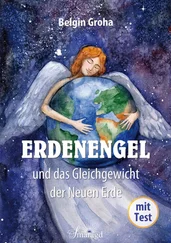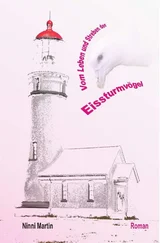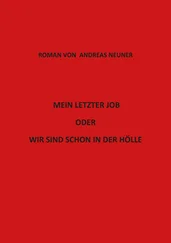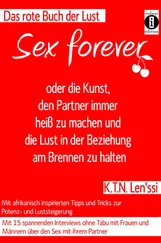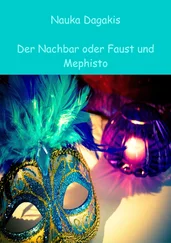Diese Phänomene des Erwerbsstrebens seien in der modernen okzidentalen Welt nicht ganz verschwunden, wie Weber meinte. Aber seiner Ansicht nach waren sie ökonomisch »irrational« und dysfunktional, und ihre Marginalisierung verlief dementsprechend parallel zur Durchsetzung des »rationalen Kapitalismus« wie des modernen Staates. Für den Ökonomen Weber war dieser »rationale Kapitalismus« historisch gesehen vergleichsweise neu und mit Blick auf seine Entstehungszeit seit der Frühen Neuzeit auch »modern«. 37Er umschrieb damit ziemlich genau das, was heute als Marktwirtschaft mit funktionierenden, freien und arbeitsteiligen Faktorenmärkten für Boden, Kapital und Arbeit bezeichnet wird. Hier herrschen idealerweise die Regeln eines kompetitiven Marktes, vermittelt nicht zuletzt durch eine stabile Geldwirtschaft und über rationale, nämlich marktkonforme »Spekulationen« an den Börsen, die das Verhalten von Marktteilnehmern steuern. Für den Staatswissenschaftler und Historiker Weber waren dabei die Funktions- und Integrationsfähigkeit des modernen Steuerstaates von Bedeutung. 38
Wenn im Folgenden vom politischen Kapitalismus gesprochen wird, geht es nicht darum, diese Erklärungen Webers, einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Modernisierungsprämissen, zu bestätigen oder zu widerlegen. 39Es soll vielmehr gezeigt werden, welche Ausformung der Kapitalismus in der Zwischenkriegszeit erlebte, was daran »politisch« war und welche Kritik sich hieran entzündete. Das führt ins Zentrum nicht nur zeitgenössischer Kapitalismusdiagnosen und der Kapitalismuskritik, 40sondern auch staatsrechtlicher Fragen etwa im Sinne eines Carl Schmitts.
Die Frage, wer Julius Barmat war, handelt von modernen Varianten dieses politischen Kapitalismus. Interessant und in unserem Zusammenhang nicht nebensächlich ist, dass der kritische Zeitbeobachter Weber offenbar schon während des Krieges nicht mehr so sicher war, ob der »rationale Kapitalismus« nicht schon bald eine »Welt von Gestern« (Stefan Zweig) sein würde. Die Kriegswirtschaft und vor allem die bald aus dem Boden schießenden Nachkriegsneuordnungspläne versprachen seiner Meinung nach nichts Gutes, wobei Weber zunächst vor allem den Einfluss großwirtschaftlicher Interessen im Auge hatte. Blühte im Krieg nicht eine »rein politisch[e] Konjunktur: von Staatslieferungen, Kriegsfinanzierungen, Schleichhandelsgewinnsten und all solchen durch den Krieg wieder gigantisch gesteigerten Gelegenheits- und Raubchancen lebenden Kapitalismus und seiner Abenteurer-Gewinnste und -Risiken [auf], der gegenüber dem der Rentabilitätskalkulation des bürgerlichen rationalen Betriebs der Friedenszeit nicht die geringste Ahnung hat«? Und nicht nur das: Vor Webers Augen stand »ein wilder Tanz um das goldene Kalb, ein hasardierendes Haschen nach jenen Zufallschancen, welche durch alle Poren dieses büreaukratischen Systems quellen«, was das Aufblühen von »Schmarotzern«, »Tagedieben« und »Ladentischexistenzen« zur Folge hatte. Das war eine Anspielung auf die »hosenverkaufenden jüdischen Jünglinge«, von denen der einflussreiche Historiker Heinrich Treitschke gesprochen hatte; Weber sprach verklausuliert von der »›Verösterreicherung‹ Deutschlands« . 41
Das sind alles Themen, mit denen sich dieses Buch auseinandersetzen wird. Dabei ist es keine Nebensächlichkeit, dass solche Positionierungen mit eklatanten religiösen, ethnischen wie rassischen Stereotypisierungen überformt waren. Denn wie die letztgenannten Zitate Webers illustrieren, schien der ältere »politische Kapitalismus« wenig mit jener »protestantischen Ethik« zu tun zu haben, in der für den Religionssoziologen der moderne »rationale Kapitalismus« wurzelte. 42Aber was war er dann? Just an diesem Punkt setzt die deutsche Selbstverständigungsdebatte über den Kapitalismus ein, die in der Auseinandersetzung Webers mit seinem Fachkollegen Werner Sombart schon vor dem Krieg begonnen hatte und die sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht.
Grenzübertritte, Grenzüberschreitungen und Grenzziehungen
Die Suche nach einer Antwort auf die Frage, wer Julius Barmat war, führt auf die Spur einer Vielzahl von Geschichten und Zusammenhängen, die sich alle in der einen oder anderen Weise mit Normverletzungen befassen. Dabei geht es um zentrale Aspekte einer Geschichte von Rechts-, Geld- und Vertrauensbeziehungen und sozialmoralischen Fragen, die in öffentlichen, seit jeher aber auch in wissenschaftlichen Debatten am Beispiel konkreter Personen verhandelt wurden, sei es als eine Geschichte von Moral und Wirtschaftssystemen, sei es als eine Geschichte des Kapitalismus. 43Die elf Kapitel dieses Buches befassen sich daher mit sehr unterschiedlichen, gleichermaßen realen, rechtlichen, symbolischen wie metaphorischen Grenzübertritten, Grenzüberschreitungen, Grenzziehungen und Grenzräumen.
Verfolgt wird ein biografischer Zugang, ohne eine wirkliche Biografie des im Mittelpunkt stehenden bekannten Unbekannten Julius Barmat zu schreiben. Es geht um konkrete Akteure und Situationen, somit eine Vielzahl von miteinander verflochtenen Mikrogeschichten, in denen uns Bilder, Emotionen wie Diskurse entgegentreten. 44Sie haben ihre jeweils eigene Valenz und sträuben sich schon wegen des ausgeprägten Eigensinns vieler der in unserer Geschichte auftauchenden Akteure häufig gegen eine schematische kategoriale Einordnung, egal ob es sich um zeitgenössische politische oder ökonomische Wissensbestände, kausale Zusammenhänge oder Karrieren von Personen handelt. Dabei ist es immer das Ziel, aus diesen Mikrogeschichten größere »Makro«-Fragen zu erschließen: sich verändernde Ordnungen des Kapitalismus in seinen verschiedenen Ausprägungen, die in allen Ländern zu beobachtende Demokratie(kritik) in Verbindung mit Korruptionsdebatten, Formen der sozialen und politischen Radikalisierung, die faschistischen Mobilisierungen Auftrieb verliehen, dann aber auch staatliche, ordnungspolitische Regulierungsbemühungen, wie sie insbesondere seit der Weltwirtschaftskrise einsetzten. Mit diesem Ansatz verknüpft sich die Prämisse, dass die Geschichte der Zwischenkriegszeit mehr ist und sein sollte, als in den wie auch immer neu abgezirkelten und thematisch proportionierten historischen Überblicksdarstellungen zum Ausdruck kommt. Die Geschichte gerade dieser Zeit zeigt eigentümliche Volten gleichermaßen der Kontinuität wie Diskontinuität, der Erwartungen und Hoffnungen einschließlich ihrer Enttäuschungen.
Aus Gründen der Lesbarkeit folgt die Darstellung einer chronologisch-systematischen Gliederung. Das beginnt mit der umstrittenen Frage der Visumsvergabe und damit der Einreise Julius Barmats in Deutschland im Jahr 1919, einer Zeit illegaler Grenzübertritte von osteuropäischen, darunter vielen jüdischen Flüchtlingen. Das erste Kapitel handelt von der Ankunft des »schwerreichen« Lebensmittelkaufmanns, der das Reichsgebiet nicht über die unbefestigte Grenze aus dem Osten, sondern aus dem Westen betrat. Der Streit darüber, wer die Verantwortung für diese Ankunft hatte, setzte schon 1918/19 ein und erreichte 1925 einen Höhepunkt. Wann kam es schon vor, dass sich in einer Person gleich alle jene Zuschreibungen wiederfinden ließen, welche die Zeitgenossen so zu empören vermochten: die des Ostjuden, des Spekulanten, des Kriegsgewinnlers, des Förderers der Sozialistischen Internationale, ja des Bolschewisten? Solche politischen und ideologischen Fragen vermischten sich mit dem scheinbar Trivialen und Alltäglichen, nämlich Brot, Butter und Speck, die Julius Barmat in großen Mengen nach Deutschland lieferte. Die Praxis der Kriegswirtschaft bildete einen zentralen Aspekt des umstrittenen »politischen Kapitalismus« der Nachkriegszeit und der frühen Weimarer Republik.
Das zweite Kapitel nimmt Julius Barmat als einen Grenzgänger des Kapitalismus in den Blick, der 1923 sein Geschäftsmodell änderte, indem er mithilfe von Krediten der Preußischen Staatsbank und der Reichspost vom lukrativen Lebensmittelhandel in den Bereich Industriekonzerngründung wechselte. Die offenbar zu jeder Zeit anzutreffenden Panegyriker des Unternehmertums wähnten ihn (wie viele andere) kurzzeitig als neue, heroische Unternehmerpersönlichkeit der Zukunft, auf den nicht zuletzt auch die Preußische Staatsbank setzte. Wie viele andere Unternehmer scheiterte der »Kriegs-, Inflations- und Deflationsgewinnler« jedoch im Zuge der Währungsstabilisierung und damit bei der Rückkehr zur vermeintlichen ökonomischen Normalität. Die Grenzen seriösen wirtschaftlichen Handelns wurden neu gezogen und die Grenzgänger des Kapitalismus aus dem Wirtschaftsleben ausgeschieden – so jedenfalls die Erwartung. Vor diesem Hintergrund werden die Auseinandersetzungen über Spekulation, Wucher und Korruption, mithin die unbestimmten Grenzen legaler und legitimer wie illegaler und illegitimer risikoreicher Praktiken verfolgt. Es geht dabei auch um Erwartungen und Diagnosen der Zeitgenossen, die sich, wie sich dann vor allem nach dem Einsetzen der Weltwirtschaftskrise zeigen sollte, erneut enttäuscht sahen.
Читать дальше