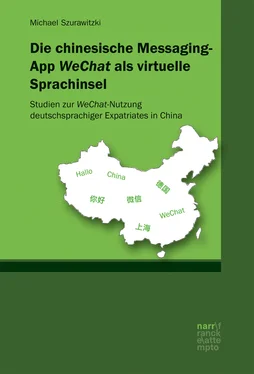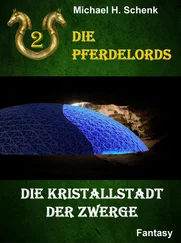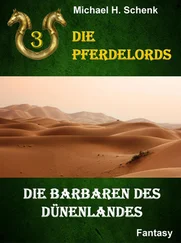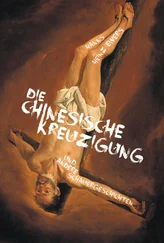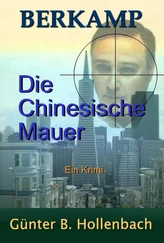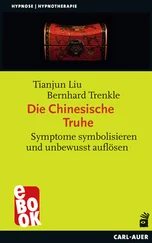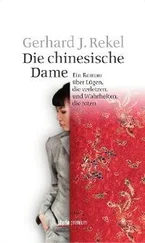Nach dem gescheiterten Vermittlungsversuch zwischen China und Japan 1937, der in der engen wirtschaftlichen Verbindung zu China einerseits und der wachsenden politischen Annhäherung an Japan andererseits seinen Grund gehabt hatte, beeinträchtigte die kriegsbedingte Spaltung Chinas in die Chungking-Regierung und die mit der japanischen Besatzungsmacht kollaborierende Nanking-Regierung unter Wang Ching-wei zunehmend auch die Kulturbeziehungen, entscheidend schließlich durch die Anerkennung der Nanking-Regierung durch Deutschland (1. Juli 1941), der die Kriegserklärung der Chungking-Regierung (8. Dez. 1941) unmittelbar folgte. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 254)
Politisch war Nazi-Deutschland mit Japan verbunden, insofern spielte China nur eine eher strategische Rolle in den Überlegungen der NS-Diktatur. Hier kam es bisweilen aber zu abwegigen Hoffnungen, Deutschland könne sich dauerhaft an ein China kontrollierendes Japan gewissermaßen ,anhängen‘ und so ohne viel eigenes Zutun profitieren (Ratenhof 1987: 546). Dazu kam, dass China lange bestrebt war, freundschaftliche Bande zu Deutschland aufrechtzuerhalten:
Hingegen versuchten die Chinesen trotz Drängens der Alliierten, so lange wie möglich freundschaftliche Verbindungen zu ihrem Modernisierungsvorbild Deutschland zu halten – ein Verhalten, das die vergangene deutsche Chinapolitik mit ihren tatsächlichen Absichten gar nicht verdient hatte. (Ratenhof 1987: 546)
Aus Umfangs- und Relevanzgründen betrachten wir hier explizit nicht die Geschehnisse während des Zweiten Weltkrieges, sondern setzen mit der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949 und der deutschen Teilung im selben Jahr an. Aufgrund der Nähe der politischen Systeme kam der DDR zunächst eine besondere Rolle zu. Sie setzte aus verständlichen Gründen der ideologischen Nähe viel früher als die Bundesrepublik Deutschland auf Kommunikation mit der VR China:
Bis Mitte der 1960er Jahre waren die deutsch-chinesischen Beziehungen vor allem von der DDR ausgestaltet worden, die bereits im Oktober 1949 mit der neuen kommunistischen Regierung in Peking Botschafter ausgetauscht hatte. Nach einem Freundschafts- und Kulturabkommen (25. Dezember 1955) konnte sich Ostberlin in den 50er Jahren hinter der Sowjetunion zum zweitgrößten Handelspartner der Volksrepublik China entwickeln. Der Studentenaustausch nahm größere Dimensionen an. Selbst als die Sowjetunion sich längst von Peking abgewandt hatte, blieben die guten Kontakte zunächst weiter bestehen. Erst ab 1963 gerieten die Beziehungen in eine ernste Krise, von der letztlich dann das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zur Volksrepublik China profitierte. (Ratenhof 1987: 554)
Die Bundesrepublik Deutschland war außenpolitisch um einen neutralen Kurs gegenüber der VR China und Taiwan bemüht (ebd.) und hatte gleichzeitig enge Beziehungen zu den USA. Die Volksrepublik China stellte wirtschaftlich einen weit attraktiveren Markt als Taiwan dar; insofern verwundert es nicht, dass die deutsche Wirtschaft trotz der politischen Andersartigkeit des Systems weiter mehr Interesse an China zeigte und am „privilegierten Partner“ (Ratenhof 1987: 555) weiter festhielt. Dies geschah jedoch nicht ohne Schwierigkeiten, da internationale Handelsbeschränkungen existierten und der Warenverkehr und Bankgeschäfte nicht ohne die Hilfe internationaler Partner realisiert werden konnten (ebd.). Hierbei gab es Anfang der 1950er Jahre sogar (nicht verwirklichte) Bestrebungen von Handelskooperationen, in die Bonn wie Ostberlin involviert hätten sein sollen. Mit der Lockerung amerikanischer Embargopolitik Mitte der 1950er Jahre konnte dann der Handel zwischen der BRD und der VR China intensiviert werden. Bis 1960 waren signifikante Steigerungen der Handelsvolumina in beide Richtungen, Import und Export, zu verzeichnen (Ratenhof 1987: 555-556). Dennoch kam es vorerst zu keiner diplomatischen Anerkennung Pekings durch Bonn (Ratenhof 1987: 556). Durch den Botschafteraustausch zwischen Frankreich und der VR China kam nochmals Bewegung in diese Angelegenheit, jedoch waren der BRD mit Rücksicht auf den Partner USA hier die Hände gebunden, auch wenn vielleicht hier bereits der Wunsch nach mehr Austausch schon existiert hatte, aber noch nicht offen kommuniziert werden konnte bzw. durfte (ebd.).
Ungeachtet der Wirren der ,Kulturrevolution‘ in China, der Blockbildung im Kalten Krieg und einer damit einhergehenden Verkomplizierung der internationalen Konstellationen konnte die deutsche Wirtschaft 1967 den Gesamthandel mit China auf über 1 Milliarde D-Mark anheben (Ratenhof 1987: 557).
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges musste sich im Bereich der kulturellen Beziehungen die Sinologie in Deutschland konsolidieren:
Die Sinologie in Deutschland hat nur langsam die Verluste aufholen können, die ihr durch den Krieg personell und materiell entstanden waren. Die Zeitschriften Sinica , Ostasiatische Zeitschrift und Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen bestehen seit Anfang der 40er Jahre nicht mehr; die international führende Asia Major mußte 1935 ihr Erscheinen einstellen und wird seit 1948 in London weitergeführt. Als Fachzeitschrift für die gesamte Ostasienwissenschaft erscheint seit 1954 Oriens Extremus , seit 1951 die Nachrichten der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Asiens . Durch Kriegsereignisse gingen die Seminarbibliotheken von Berlin, Leipzig, Göttingen und Frankfurt verloren; die reichen chinesischen Bestände der Preußischen Staatsbibliothek verteilten sich nach 1945 auf mehrere Besatzungszonen. Sinologische Lehrstühle gab es 1945 nur in Hamburg, Berlin und Leipzig. Zu ihnen trat 1946 die schon lange geplant gewesene Professur in München. (Franke 1974: Sp. 1234)
Seit 1960 forcierte die Politik auf Empfehlung des Wissenschaftsrates eine wesentliche Ausweitung der akademischen Sinologie (Franke 1974: Sp. 1234-1235). Mit Blick auf die später wieder intensivierten Wirtschafts- und Kulturbeziehungen (vgl. 2.5. und 2.6. unten) stellte sich diese Weichenstellung aus heutiger Sicht günstig dar und bereitete den Boden für den heute sehr regen Austausch zwischen Deutschland und China.
Eine politische Annäherung von Deutschland und China begann in den 1970er Jahren unter der Ägide der sozial-liberalen Koalition in Bonn:
Weit intensiver, als es jemals zuvor eine Regierung in Bonn getan hatte, widmete sich schließlich die SPD/FDP-Koalitionsregierung China, wenn auch zunächst äußerst behutsam und ohne größere Erfolge: Bonn wollte unter allen Umständen eine Gefährdung seiner neuen Ostpolitik vermeiden – Moskau besaß absolute Priorität –, und Peking warb weiterhin um Ostberlin. […] Erst im Zuge der amerikanisch-chinesischen Entspannung kam es dann zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Peking (10. Oktober 1972).1 Ein offizielles Handelsabkommen folgte wenig später (5. Juli 1973), ergänzt durch eine Vereinbarung über Zivilluftfahrt und Seeverkehr (Oktober 1975). Als besonders vorteilhaft erwies es sich dabei für die Bundesregierung, daß Bonn Taiwan nicht anerkannt hatte und lediglich kulturelle und wirtschaftliche Kontakte dorthin unterhielt […]. (Ratenhof 1987: 557)
Taiwan war bis dahin ein vom Volumen her viel größerer Wirtschaftspartner der BRD gewesen als die VR China. Durch die neuen Vereinbarungen änderte sich dies jedoch sehr schnell zugunsten Chinas. (Ratenhof 1987: 557-558)
Im vorliegenden Abschnitt folgen wir der Darstellung der deutsch-chinesischen Beziehungen bei Huang (2019; Kap. 3.1.2.). Deutsche Politiker, beginnend mit Franz Josef Strauß (CSU) 1975, begannen China zu besuchen und schlugen somit ein neues Kapitel der Annäherung auf. Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) wurde im Oktober 1975 von Mao Zedong in Peking empfangen (Huang 2019: 39). Im Dezember 1978 verkündete China die offizielle Reform- und Öffnungspolitik; „[d]anach fanden regelmäßige hochrangige Staatsbesuche zwischen Bonn und Peking“ (ebd.) statt. Diese dienten einer Annäherung beider Seiten, allmählich adjustierte die Volksrepublik China gewisse Aspekte ihres politischen Systems:
Читать дальше