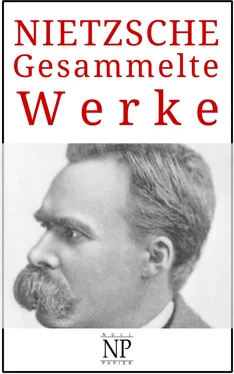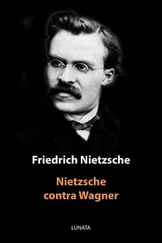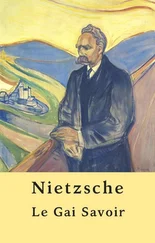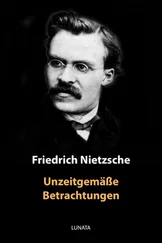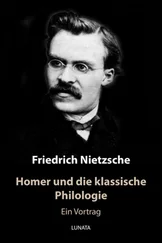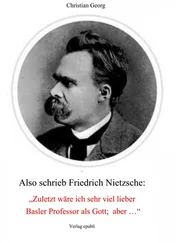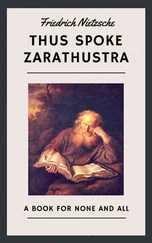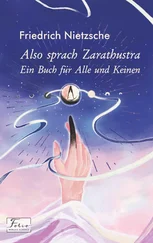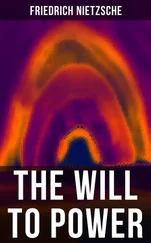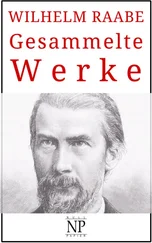Kant, mit seiner »praktischen Vernunft«, mit seinem Moral-Fanatismus ist ganz 18. Jahrhundert; noch völlig außerhalb der historischen Bewegung; ohne jeden Blick für die Wirklichkeit seiner Zeit, z. B. Revolution; unberührt von der griechischen Philosophie; Phantast des Pflichtbegriffs; Sensualist, mit dem Hinterhang der dogmatischen Verwöhnung –.
Die Rückbewegung auf Kant in unserem Jahrhundert ist eine Rückbewegung zum achtzehnten Jahrhundert : man will sich ein Recht wieder auf die alten Ideale und die alte Schwärmerei verschaffen, – darum eine Erkenntnißtheorie, welche »Grenzen setzt«, das heißt erlaubt, ein Jenseits der Vernunft nach Belieben anzusetzen …
Die Denkweise Hegel’s ist von der Goethe’ schen nicht sehr entfernt: man höre Goethe über Spinoza . Wille zur Vergöttlichung des Alls und des Lebens, um in seinem Anschauen und Ergründen Ruhe und Glück zu finden; Hegel sucht Vernunft überall, – vor der Vernunft darf man sich ergeben und bescheiden . Bei Goethe eine Art von fast freudigem und vertrauendem Fatalismus , der nicht revoltirt, der nicht ermattet, der aus sich eine Totalität zu bilden sucht, im Glauben, daß erst in der Totalität Alles sich erlöst, als gut und gerechtfertigt erscheint.
*
96.
Periode der Aufklärung , – darauf Periode der Empfindsamkeit . Inwiefern Schopenhauer zur »Empfindsamkeit« gehört (Hegel zur Geistigkeit).
*
97.
Das 17. Jahrhundert leidet am Menschen wie an einer Summe von Widersprüchen (» l’amas de contradictions «, der wir sind); es sucht den Menschen zu entdecken, zu ordnen , auszugraben: während das 18. Jahrhundert zu vergessen sucht, was man von der Natur des Menschen weiß, um ihn an seine Utopie anzupassen. »Oberflächlich, weich, human«, – schwärmt für »den Menschen« –
Das 17. Jahrhundert sucht die Spuren des Individuums auszuwischen, damit das Werk dem Leben so ähnlich als möglich sehe. Das 18. sucht durch das Werk für den Autor zu interessiren . Das 17. Jahrhundert sucht in der Kunst Kunst, ein Stück Cultur: das 18. treibt mit der Kunst Propaganda für Reformen socialer und politischer Natur.
Die »Utopie«, der »ideale Mensch«, die Natur-Angöttlichung, die Eitelkeit des Sich-in-Scene-setzens, die Unterordnung unter die Propaganda socialer Ziele, die Charlatanerie – das haben wir vom 18. Jahrhundert.
Der Stil des 17. Jahrhunderts: propre, exact et libre.
Das starke Individuum, sich selbst genügend oder vor Gott in eifriger Bemühung – und jene moderne Autoren-Zudringlichkeit und -Zuspringlichkeit – das sind Gegensätze. »Sich-produciren« – damit vergleiche man die Gelehrten von Port-Royal.
Alfieri hatte einen Sinn für großen Stil.
Der Haß gegen das Burleske (Würdelose), der Mangel an Natursinn gehört zum 17. Jahrhundert.
*
98.
Gegen Rousseau. – Der Mensch ist leider nicht mehr böse genug; die Gegner Rousseau’s, welche sagen »der Mensch ist ein Raubthier«, haben leider nicht Recht. Nicht die Verderbniß des Menschen, sondern seine Verzärtlichung und Vermoralisirung ist der Fluch. In der Sphäre, welche von Rousseau am heftigsten bekämpft wurde, war gerade die relativ noch starke und wohlgerathene Art Mensch (– die, welche noch die großen Affekte ungebrochen hatte: Wille zur Macht, Wille zum Genuß, Wille und Vermögen zu commandiren). Man muß den Menschen des 18. Jahrhunderts mit dem Menschen der Renaissance vergleichen (auch dem des 17. Jahrhunderts in Frankreich), um zu spüren, worum es sich handelt: Rousseau ist ein Symptom der Selbstverachtung und der erhitzten Eitelkeit – beides Anzeichen, daß es am dominirenden Willen fehlt: er moralisirt und sucht die Ursache seiner Miserabilität als Rancune-Mensch in den herrschenden Ständen.
*
99.
Voltaire – Rousseau . – Der Zustand der Natur ist furchtbar, der Mensch ist Raubthier; unsere Civilisation ist ein unerhörter Triumph über diese Raubthier-Natur: – so schloß Voltaire . Er empfand die Milderung, die Raffinements, die geistigen Freuden des civilisirten Zustandes; er verachtete die Bornirtheit, auch in der Form der Tugend; den Mangel an Delikatesse auch bei den Asketen und Mönchen.
Die moralische Verwerflichkeit des Menschen schien Rousseau zu präoccupiren; man kann mit den Worten »ungerecht«, »grausam« am meisten die Instinkte der Unterdrückten aufreizen, die sich sonst unter dem Bann des vetitum und der Ungnade befinden: sodaß ihr Gewissen ihnen die aufrührerischen Begierden widerräth . Diese Emancipatoren suchen vor Allem Eins: ihrer Partei die großen Accente und Attitüden der höheren Natur zu geben.
*
100.
Rousseau : die Regel gründend auf das Gefühl; die Natur als Quelle der Gerechtigkeit; der Mensch vervollkommnet sich in dem Maaße, in dem er sich der Natur nähert (– nach Voltaire in dem Maaße, in dem er sich von der Natur entfernt ). Dieselben Epochen für den Einen die des Fortschritts der Humanität , für den Andern Zeiten der Verschlimmerung von Ungerechtigkeit und Ungleichheit.
Voltaire noch die umanità, im Sinne der Renaissance begreifend, insgleichen die virtù (als »hohe Cultur«), er kämpft für die Sache der »honnêtes gens« und »de la bonne compagnie«, die Sache des Geschmacks, der Wissenschaft, der Künste, die Sache des Fortschritts selbst und der Civilisation.
Der Kampf gegen 1760 entbrannt : der Genfer Bürger und le seigneur de Ferney. Erst von da an wird Voltaire der Mann seines Jahrhunderts, der Philosoph, der Vertreter der Toleranz und des Unglaubens (bis dahin nur un bel esprit). Der Neid und der Haß auf Rousseau’s Erfolg trieb ihn vorwärts, »in die Höhe«.
Pour »la canaille« un dieu rémunérateur et vengeur – Voltaire.
Kritik beider Standpunkte in Hinsicht auf den Werth der Civilisation . Die sociale Erfindung die schönste, die es für Voltaire giebt: es giebt kein höheres Ziel, als sie zu unterhalten und zu vervollkommnen; eben Das ist die honnêteté, die socialen Gebräuche zu achten; Tugend ein Gehorsam gegen gewisse nothwendige »Vorurtheile« zu Gunsten der Erhaltung der »Gesellschaft«. Cultur-Missionär , Aristokrat, Vertreter der siegreichen, herrschenden Stände und ihrer Werthungen. Aber Rousseau blieb Plebejer , auch als homme de lettres, das war unerhört ; seine unverschämte Verachtung alles Dessen, was nicht er selbst war.
Читать дальше