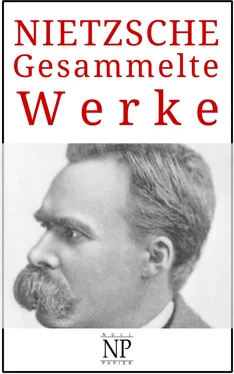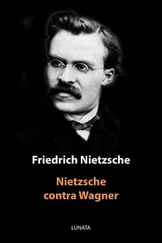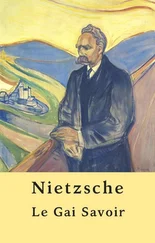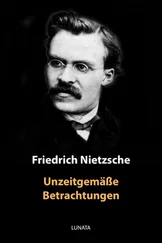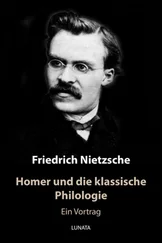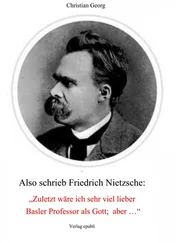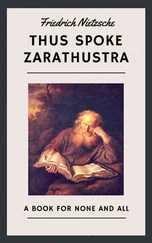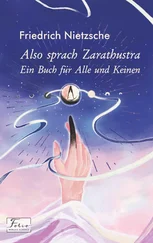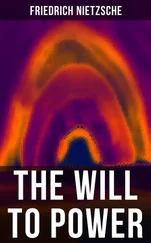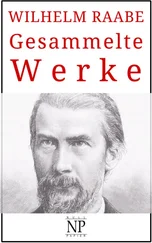Wir haben in der Reformation ein wüstes und pöbelhaftes Gegenstück zur Renaissance Italiens, verwandten Antrieben entsprungen, nur daß diese im zurückgebliebenen, gemein gebliebenen Norden sich religiös verkleiden mußten, – dort hatte sich der Begriff des höheren Lebens von dem des religiösen Lebens noch nicht abgelöst.
Auch mit der Reformation will das Individuum zur Freiheit; »Jeder sein eigner Priester« ist auch nur eine Formel der Libertinage. In Wahrheit genügte Ein Wort – »evangelische Freiheit« – und alle Instinkte, die Grund hatten, im Verborgenen zu bleiben, brachen wie wilde Hunde heraus, die brutalsten Bedürfnisse bekamen mit Einem Male den Muth zu sich, Alles schien gerechtfertigt … Man hütete sich zu begreifen, welche Freiheit man im Grunde gemeint hatte, man schloß die Augen vor sich … Aber daß man die Augen zumachte und die Lippen mit schwärmerischen Reden benetzte, hinderte nicht, daß die Hände zugriffen, wo Etwas zu greifen war, daß der Bauch der Gott des »freien Evangeliums« wurde, daß alle Rache- und Neid-Gelüste sich in unersättlicher Wuth befriedigten …
Dies dauerte eine Weile: dann kam die Erschöpfung, ganz so wie sie im Süden Europa’s gekommen war; und auch hier wieder eine gemeine Art Erschöpfung, ein allgemeines ruere in servitutem … Es kam das unanständige Jahrhundert Deutschlands …
*
94.
Die Ritterlichkeit als die errungene Position der Macht: ihr allmähliches Zerbrechen (und zum Theil Übergang in’s Breitere, Bürgerliche). Bei Larochefoucauld ist Bewußtsein über die eigentlichen Triebfedern der Noblesse des Gemüths da – und christlich verdüsterte Beurtheilung dieser Triebfedern.
Fortsetzung des Christenthums durch die französische Revolution. Der Verführer ist Rousseau: er entfesselt das Weib wieder, das von da an immer interessanter – leidend – dargestellt wird. Dann die Sclaven und Mistreß Beecher-Stowe. Dann die Armen und die Arbeiter. Dann die Lasterhaften und Kranken, – Alles das wird in den Vordergrund gestellt (selbst um für das Genie einzunehmen, wissen sie seit fünfhundert Jahren es nicht anders als den großen Leidträger darzustellen!). Dann kommt der Fluch auf die Wollust (Baudelaire und Schopenhauer); die entschiedenste Überzeugung, daß Herrschsucht das größte Laster ist; vollkommene Sicherheit darin, daß Moral und désintéressement identische Begriffe sind; daß das »Glück Aller« ein erstrebenswerthes Ziel sei (d.h. das Himmelreich Christi). Wir sind auf dem besten Wege: das Himmelreich der Armen des Geistes hat begonnen. – Zwischenstufen: der Bourgeois (in Folge des Geldes Parvenu) und der Arbeiter (in Folge der Maschine).
Vergleich der griechischen Cultur und der französischen zur Zeit Ludwig’s XIV. Entschiedener Glaube an sich selber. Ein Stand von Müßigen, die es sich schwer machen und viel Selbstüberwindung üben. Die Macht der Form, Wille, sich zu formen. »Glück« als Ziel eingestanden. Viel Kraft und Energie hinter dem Formenwesen. Der Genuß am Anblick eines so leicht scheinenden Lebens. – Die Griechen sahen den Franzosen wie Kinder aus.
*
95.
Die drei Jahrhunderte.
Ihre verschiedene Sensibilität drückt sich am besten so aus:
Aristokratismus: Descartes, Herrschaft der Vernunft, Zeugniß von der Souveränetät des Willens;
Feminismus: Rousseau, Herrschaft des Gefühls , Zeugniß von der Souveränetät der Sinne , verlogen;
Animalismus: Schopenhauer, Herrschaft der Begierde , Zeugniß von der Souveränetät der Animalität , redlicher, aber düster.
Das 17. Jahrhundert ist aristokratisch , ordnend, hochmüthig gegen das Animalische, streng gegen das Herz, »ungemüthlich«, sogar ohne Gemüth, »undeutsch«, dem Burlesken und dem Natürlichen abhold, generalisirend und souverän gegen Vergangenheit: denn es glaubt an sich. Viel Raubthier au fond , viel asketische Gewöhnung, um Herr zu bleiben. Das willensstarke Jahrhundert; auch das der starken Leidenschaft.
Das 18. Jahrhundert ist vom Weibe beherrscht, schwärmerisch, geistreich, flach, aber mit einem Geiste im Dienst der Wünschbarkeit, des Herzens, libertin im Genusse des Geistigsten, alle Autoritäten unterminirend; berauscht, heiter, klar, human, falsch vor sich, viel Canaille au fond , gesellschaftlich …
Das 19. Jahrhundert ist animalischer , unterirdischer, häßlicher, realistischer, pöbelhafter, und ebendeshalb »besser«, »ehrlicher«, vor der »Wirklichkeit« jeder Art unterwürfiger, wahrer ; aber willensschwach, aber traurig und dunkel-begehrlich, aber fatalistisch. Weder vor der »Vernunft«, noch vor dem »Herzen« in Scheu und Hochachtung; tief überzeugt von der Herrschaft der Begierde (Schopenhauer sagte »Wille«; aber Nichts ist charakteristischer für seine Philosophie, als daß das eigentliche Wollen in ihr fehlt). Selbst die Moral auf Einen Instinkt reducirt (»Mitleid«).
Auguste Comte ist Fortsetzung des 18. Jahrhunderts (Herrschaft von cœur über la tête , Sensualismus in der Erkenntnistheorie, altruistische Schwärmerei).
Daß die Wissenschaft in dem Grade souverän geworden ist, das beweist, wie das 19. Jahrhundert sich von der Domination der Ideale losgemacht hat. Eine gewisse »Bedürfnißlosigkeit« im Wünschen ermöglicht uns erst unsere wissenschaftliche Neugierde und Strenge – diese unsere Art Tugend …
Die Romantik ist Nachschlag des 18. Jahrhunderts; eine Art aufgethürmtes Verlangen nach dessen Schwärmerei großen Stils (– thatsächlich ein gut Stück Schauspielerei und Selbstbetrügerei: man wollte die starke Natur , die große Leidenschaft darstellen).
Das 19. Jahrhundert sucht instinktiv nach Theorien , mit denen es seine fatalistische Unterwerfung unter das Tatsächliche gerechtfertigt fühlt. Schon Hegel’s Erfolg gegen die »Empfindsamkeit« und den romantischen Idealismus lag im Fatalistischen seiner Denkweise, in seinem Glauben an die größere Vernunft auf Seiten des Siegreichen, in seiner Rechtfertigung des wirklichen »Staates« (an Stelle von »Menschheit« u.s.w.). – Schopenhauer: wir sind etwas Dummes und, besten Falls, sogar etwas Sich-selbst-Aufhebendes. Erfolg des Determinismus, der genealogischen Ableitung der früher als absolut geltenden Verbindlichkeiten, die Lehre vom milieu und der Anpassung, die Reduktion des Willens auf Reflexbewegungen, die Leugnung des Willens als »wirkender Ursache«; endlich – eine wirkliche Umtaufung: man sieht so wenig Wille, daß das Wort frei wird, um etwas Anderes zu bezeichnen. Weitere Theorien: die Lehre von der Objektivität , »willenlosen« Betrachtung, als einzigem Weg zur Wahrheit; auch zur Schönheit (– auch der Glaube an das »Genie«, um ein Recht auf Unterwerfung zu haben); der Mechanismus, die ausrechenbare Starrheit des mechanischen Processes; der angebliche »Naturalismus«, Elimination des wählenden, richtenden, interpretirenden Subjekts als Princip –
Читать дальше