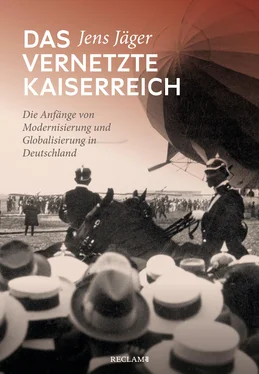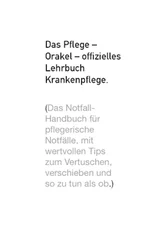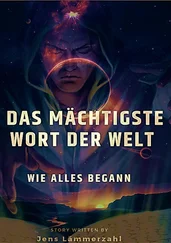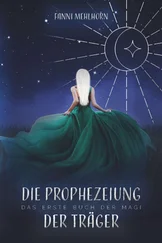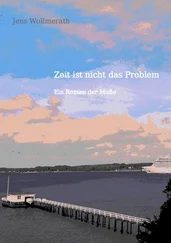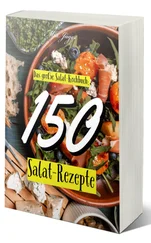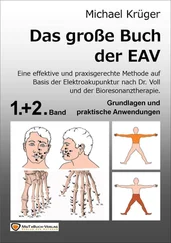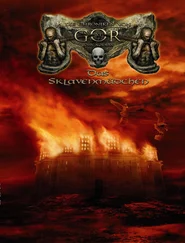Warum wuchs die Bevölkerung im Kaiserreich? Und wie verteilte sich diese Bevölkerung auf die Fläche? Bevölkerungen wachsen dann, wenn es – banal ausgedrückt – einerseits übers Jahr gerechnet mehr Geburten als Sterbefälle gibt und andererseits nicht mehr Personen ein Erfassungsgebiet verlassen als zuwandern. Für den gesamten Zeitraum von 1871 bis 1914 gilt die magere Tatsache eines Nettogewinns, während sich die Bevölkerungsverteilung auf der Fläche massiv räumlich veränderte.
Schauen wir uns zunächst die natürliche Bevölkerungsbewegung an. Sie lässt sich in zwei Aspekte gliedern: erstens die Fertilität (also Geburtenentwicklung) und zweitens die Mortalität (also Sterbeentwicklung). Das Bevölkerungswachstum verdankte sich einer abnehmenden Säuglings- und Kindersterblichkeit, aber auch einer abnehmenden Mortalität, d. h., die Menschen starben weniger (früh) an Krankheiten und wurden zunehmend älter. In Zahlen: Die Sterberate sank von 28,3 pro mille (1866–70) auf 16,3 (1909–13) – gegenwärtig liegt sie bei etwa 10 pro mille.
Die Geburtenrate lag 1871 bei 38,5 pro mille und erreichte 1876 einen Höhepunkt von 40,9. Danach sank sie langsam ab und erreichte schließlich 28,6 im Zeitraum 1909–13. Damit gemeint sind im Übrigen nicht die Geburten insgesamt, sondern lediglich die Lebendgeborenen. Es gab jedenfalls zwischen 1871 und 1914 nicht ein Jahr, in dem kein Geburtenüberschuss zu verzeichnen war – dieser schwankte allerdings jährlich. 1871 lag er auf seinem niedrigsten Niveau, um die Jahrhundertwende erreichte er seinen Höchststand.
Die Wachstumsraten lagen zumeist bei über einem Prozent, am höchsten im Jahrzehnt 1896–1905, am niedrigsten im Jahrzehnt 1871–80. Diese statistischen Durchschnittszahlen gilt es etwas aufzuschlüsseln, und zwar nach Regionen und sozialer Herkunft. Interessante Unterschiede finden wir beim Heiratsalter. Das ist deswegen bedeutsam, weil für die wirtschaftliche Situation und den sozialen Status einer Person eine eheliche Geburt wichtig und damit von erheblicher Bedeutung war.
Die hohen Unehelichkeitsquoten der früheren Jahrzehnte nahmen zwar ab,21 doch die Ehen wurden eher spät geschlossen: In den Städten waren die Männer bei ihrer Hochzeit im Schnitt 29 Jahre alt, die Frauen 25,7. Auf dem Land lagen die Heiratsalter bei 27 und 24,5 Jahren. Auch dort gab es aber größere Unterschiede. Gut gebildete Männer heirateten erst jenseits der 30 Jahre, und unter den Frauen traten die Lehrerinnen erst mit durchschnittlich 29 Jahren in eine Ehe ein. Der Lehrberuf gehörte zu den wenigen Berufen mit einer längeren Ausbildung, die Frauen offenstanden und für bürgerliche Frauen als »standesgemäß« gelten konnten. Frauen, die diesen Beruf ergriffen, riskierten durch die Eheschließung zudem, ihre Tätigkeit aufgeben zu müssen. Diese Faktoren zusammengenommen erklären das vergleichsweise hohe Heiratsalter von Lehrerinnen.
Das Alter der Eheleute wirkte sich naturgemäß auf die Kinderzahl aus; späte Heiraten führten dazu, dass die Kinderzahl innerhalb der Ehen sank. Das bemerkten auch die Zeitgenossen. So stieg zwar der Geburtenüberschuss – da die Kindersterblichkeit aus medizinischen, hygienischen und ernährungsphysiologischen Gründen zurückging –, gleichzeitig aber sank die Zahl der Geburten pro Frau: Auf 1000 Frauen im Alter von 15 bis 45 kamen 1890/91 noch 163 Geburten, diese Zahl sank aber bis 1912/13 auf 117. Auch diesbezüglich gab es ein Land-Stadt Gefälle. Dazu kamen konfessionelle Unterschiede: In katholischen Gebieten wurden mehr Kinder geboren als in protestantischen, obschon die Zahl dort später auch abnahm. Dieses Muster zeigte sich generell in Europa. In eher protestantischen, urbanisierten Gesellschaften setzte sich individuelle Geburtenkontrolle früher durch, da der Erziehung des einzelnen Kindes mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Man investierte mehr in die Erziehung und Ausbildung der Kinder, und das Familienideal verschob sich hin zu kleineren Familien. Insgesamt handelt es sich um ein hochkomplexes vielfältiges Phänomen, das an dieser Stelle nur ansatzweise erklärt werden kann. Grob ist jedenfalls erkennbar, dass in ländlichen katholischen Gebieten die Geburten- und Sterbeziffern später sanken als in urbanen, protestantischen Räumen. Es existierte auch ein Ost-West- und ein Süd-Nord-Gefälle.
Für eine Reihe von Zeitgenossen waren dies alarmierende Anzeichen einer sich verändernden Gesellschaft, denn man fand, dass sich die Bürger, d. h. diejenigen, die sich für die Stütze des Kaiserreichs hielten, zu wenig reproduzierten, wohingegen Arme – darunter Arbeiter (potentielle Sozialisten also) – im Vergleich zu viele Kinder bekämen. Dem Rückgrat des Staates, der protestantisch-bürgerlichen Schicht, machte zudem Sorgen, dass Katholiken mehr Kinder hatten. Auf sehr lange Sicht schien dies die protestantische Dominanz zu gefährden. Neben der »Rückständigkeit« von Landvolk und Katholiken allgemein wurde die Großstadt als »Schuldige« am bürgerlichen Geburtenrückgang identifiziert. Und das war deswegen für die Zeitgenossen besonders bedenklich, weil die Urbanisierung im Kaiserreich rasch voranschritt.
Zusammengefasst ergibt sich für die natürliche Bevölkerungsentwicklung das Bild einer steten Zunahme, die in erster Linie der abnehmenden Säuglingssterblichkeit zuzurechnen ist, in zweiter Linie einer sinkenden Sterbeziffer (die Leute waren gesünder und lebten länger als früher). Interessanterweise waren zwar eine sinkende Geburtenrate und Fruchtbarkeitsziffer je Frau zu verzeichnen, da es aber insgesamt mehr Menschen gab, die länger lebten, blieb das Wachstum der Bevölkerung erhalten. Bevölkerungszunahme bedeutet aber auch immer, dass die Gesellschaft insgesamt relativ jung war; zur Zeit des Kaiserreichs waren immer über 40 Prozent der Bevölkerung unter 20 Jahre alt.
Damit sind wir bei der räumlichen Bevölkerungsbewegung und können uns der Binnen-, Fern- und Auswanderung widmen. Die Menschen im Kaiserreich waren – freiwillig oder gezwungenermaßen – erstaunlich mobil. Viele blieben teils nur saisonal an einem Ort, zogen häufig um, bewegten sich vom Dorf in die Stadt und umgekehrt. Auch ein bemerkenswert großer Teil der Auswanderer kehrte wieder zurück ins Kaiserreich; aus den USA soll die Heimkehrerquote bis zu 20 Prozent betragen haben. Das alles hat die zeitgenössische Statistik sorgfältig erfasst, wenngleich unter den national zusammengerechneten Werten die großen lokalen und regionalen Unterschiede ebenso verschwinden wie die sozialen Zuordnungen.
Die Mehrheit der mobilen Personen gehörte den Unterschichten an; sehr viele jüngere Männer wechselten häufig ihren Wohn- und Arbeitsort. »Die Folge dieser riesenhaften Mobilisierung war, dass im Jahr 1907 die Hälfte der Deutschen nicht mehr an ihrem Geburtsort lebten, und ein Drittel außerhalb ihres [Bundes-]Staates oder ihrer Provinz«, hat der Historiker Thomas Mergel errechnet.22 Aus der Mobilität folgte jedoch nicht notwendig die endgültige Loslösung vom Herkunftsort oder der Familie – die saisonale Wanderung und die Rückkehrer deuten das schon an. Unter den verkehrs- und kommunikationstechnischen Bedingungen des Kaiserreichs (kurz: Eisenbahn und Post) konnten Beziehungen auch über längere Entfernungen und dauerhaft aufrechterhalten werden.
Dass sich die Verteilung der Bevölkerung in den 40 Jahren des Kaiserreichs erheblich veränderte, haben wir anhand der Wahlkreise schon gesehen. Als sichtbarstes Phänomen kann die zunehmende Verstädterung der Bevölkerung gelten. 1871 lebte die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung noch auf dem Land, im Dorf oder in sehr kleinen Städten. Die zeitgenössischen Statistiker zogen die Grenze zur »Stadt« bei 2000 Einwohnern. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs hatte sich das Verhältnis fast umgekehrt. Nun lebten 60 Prozent der Menschen in Städten mit über 2000 Bewohnern.
Читать дальше