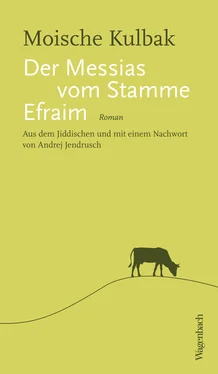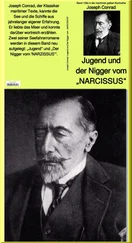Er ging zur Tür und wollte schon ins Zimmer treten, als ihm etwas Einhalt gebot: Er hörte eine Stimme voller Tränen und Freude.
Eines trüben Abends stand Levi Pataschnik am offenen Geldschrank wie vor einem geöffneten Toraschrein, das weichende Tageslicht legte sich auf die schattigen Tapeten, schimmerte und malte helle Flecken auf die dunklen Dielen. Ein Haufen funkelnder Münzen glühte rot aus dem Schrank, blitzte und stach ihm ins Herz. Atemlos wühlte Levi im Geld.
Er ließ das Gold langsam durch seine Hände gleiten, wie man weichen Sand durch die Finger rinnen läßt, und lauschte scharf seinem Klang, dem unverwechselbaren Klang des Goldes.
Seine feiste Hand, rosig gefärbt vom vergehenden Tag, strich über die Münzen und berührte sie zärtlich wie ein Bursche das Haar seines Mädchens.
Ein geheimes tiefes Summen drang aus dem Schrank. Gold!
Ströme von Gold pulsieren unter der Erde, und die Augen der Menschen funkeln golden.
Und oben, über den goldenen Sternen, thront Gott auf seinem Königsstuhl von Gold.
Levi Pataschnik schloß sacht die schwere Tür des Geldschranks und hielt sich an der Oberkante fest, um nicht zu fallen. Sein Kopf sank ihm schwer auf die Brust.
Der unermeßliche Abend kroch nagend ins Zimmer.
Mit gesenktem heißem Kopf lehnte sich Reb Levi an das kalte Eisen des Schranks, die Knie knickten ihm vor Müdigkeit ein, die Augen fielen ihm zu, und tief in seiner Brust löste sich ein schwerer glühender Tropfen. Er fiel in sein inneres Dunkel hinab und zerschnitt ihm die Eingeweide mit siedendem Schmerz.
Im Schatten der Tür stand der älteste Gast.
Unweit der Mühle, ein paar Werst entfernt, wohnte ein Jude im Wald: Reb Simche Plachte.
Er hatte hart gearbeitet und sich gesagt: Hart ist das Leben so oder so, also lebe ich besser im Wald.
Er hatte sich ein Häuschen aus Zweigen und Gras gebaut und die Wände innen und außen mit Lehm verschmiert. Reb Simche Plachte war ein fröhlicher Mann, er nährte sich von Gemüse, trank Wasser und rauchte ein Kraut, das er selbst zubereitete.
Reb Simche hielt Hühner und Tauben. Hühner hielt er, weil sie Eier legten, die zum Essen taugten, und Tauben, weil sie Eier legten, die nicht zum Essen taugten.
Reb Simche traf sich mit niemandem, er war auch so glücklich.
Er lächelte ständig – rauchte seine Pfeife, schloß halb die Augen und lächelte: Zu wem, das wußte man nicht. Er redete laut mit sich selbst, denn er war immer allein.
Im Winter saß er in seiner Hütte und erzählte sich Anekdoten, im Sommer suchte er frische Wiesen und Waldlichtungen auf und vollführte dort allerlei Tänze.
Er war ein großartiger Tänzer!
Und der Frühling machte ihn vollkommen trunken: Als Sechzigjähriger stieg er dann auf die Bäume mit der Gewandtheit eines Buben.
Er betrug sich, als er wäre er nicht ganz bei Sinnen.
Reb Simche aß gerne die Blütenknospen der Bäume. Er kletterte durchs Zweiggeflecht und sang wie ein Kanarienvogel.
So lebte er dort im Wald.
Ja, Reb Simche sah aus wie ein Goi, auf dem Kopf trug er einen Strohhut und an den Füßen Schuhe aus Birkenbast, aber er hatte einen Bart, einen gewaltigen jüdischen Bart von lichtem Grau.
Sein Bart war wunderschön!
Als junger Mann war Reb Simche Wasserträger gewesen, in späteren Jahren wurde er dann ein chassidischer Rabbi, der bekanntlich einen frommen Tisch führt und ein großes Gefolge hat. Doch das Leben unter den Menschen war ihm gar zu beschwerlich. So ging er fort und ließ sich nieder im Wald.
Als Eremit.
Und wenn der Wind über Baumkronen bläst und Zweige abbricht, was tut Simche Plachte dann?
Mit der Pfeife im Mund sitzt er auf einem entwurzelten Stamm im Unterholz und lauscht und lauscht:
Die Nester fallen aus den Bäumen.
Angstvoll fliegen die Vogelmütter zur Erde hinab, doch ihre geschlüpften Küken sind schon tot. Nur da und dort regt sich noch ein nackter Flügel.
Ein Klagen hebt an.
Dann sitzt Reb Simche im Dickicht, er lauscht und lauscht, alle Haare am Körper sträuben sich ihm und zittern. Seine Zähne leuchten durch das Unterholz, und die Augen brennen vom Sturm.
Und wenn ein langer blauer Blitz in den Wald fährt und mit brennender Peitsche über die Bäume schlägt, was tut Simche Plachte dann?
Er richtet sich auf, die Hände zum Himmel gestreckt, und will ihn packen, den Blitz in seinem Lauf, und sein Bart ist zerzaust, und von seiner zottigen Brust steigt der Wasserdampf.
Simche Plachte war selber ein Wald!
Aber wenn es still wird.
Wenn der klare nasse Wald die Rufe der Kuckucksvögel erwidert und die Walderdbeeren wie Blutspritzer im Grase liegen.
Ja, dann!
Dann geht Simche Plachte durch den hallenden Wald, die Hände auf dem Rücken verschränkt, den Kopf hoch erhoben.
Und er trällert.
Und er schnalzt mit der Zunge
Und er schwingt seine Füße.
Tirili und tirila!
Er kannte kein Schamgefühl.
So lebte er allein im Wald.
Es war ein lieblicher Sommertag.
Reb Simche Plachte trat aus dem Wald und stellte sich auf die Landstraße. Er schlug einen Feldweg ein.
Nach ein paar Schritten stieß Simche Plachte auf eine Senke und sah eine Kuh grasen. Wie kam eine Kuh hierher?
Als er weiter hinunterging, sah er einen Juden im Morast sitzen, mitten im Dreck, einen Mann mit großem, geschwollenem Kopf und langen Armen, die ihm bis zu den Knöcheln reichten. Er hielt ein Psalmenbuch in der Hand, betete, wiegte seinen Oberkörper und war schwarz wie ein Stück Kohle.
Was bedeutete das?
Er blieb stehen und fragte:
»Wieso hast du dich hierher gesetzt?«
Der Jude gab schnaufend zur Antwort:
»Wo soll ich sonst sitzen?«
»Wo du sitzen sollst? Im Himmel, mein Lieber!«
Der Mann im Dreck erzählte ihm, warum und wieso: Es war Benje, der Müller.
Und Reb Benje erhob sich, schaute ihn mit flehenden Augen an und sagte:
»Hilf mir, mein Freund!«
Doch Reb Simches Gedanken waren schon woanders. Er fragte Reb Benje nach der Kuh:
»Gibt sie Milch?«
»Sicher gibt sie Milch.«
»Kann man ein wenig von der Milch probieren?«
Reb Benje meinte, daß er keinen Melkeimer hätte.
»Wozu einen Eimer?! Wer braucht schon einen Eimer?«
Und Reb Simche Plachte trat an die Kuh heran, kroch auf allen vieren unter sie wie ein Kalb und sog mit gierigen Schlucken die Milch aus ihrem Euter.
Er lief rot an, und Schweiß trat ihm auf die Stirn.
Die zehn Sefirot (Attribute der Gottheit)
Tausende Welten liegen im Mysterium der zehn Sefirot.
Die Seele des Menschen wandelt durch den Kristall der Welten und hallt wider im Klang der Sefira, in der sie sich findet.
Und wisse, Tausende Welten ruhen im Schein jeder einzelnen Sefira und in dem aller zusammen: Dies ist das Geheimnis der Einzahl der Zehn und der Zehnzahl des Einen.
Der Unendliche, der in Gestalt der zehn Sefirot einherkommt, umschließt alle Zahlen und ist erfüllt vom heiligen Glanz der Ewigkeit, und das Heilige der Ewigkeit läßt sich nicht fassen in Maß und Eigenart.
Und wisse, so wenig wir zu scheiden vermögen zwischen den zehn Sefirot nach dem Grad der ihnen innewohnenden Heiligkeit, so wenig ermessen können wir den Raum zwischen ihnen.
Denn das Mysterium von »der Einzahl der Zehn und der Zehnzahl des Einen« gilt nicht nur für das Leben, wie es sich fortsetzt, sondern auch für das Leben, das sich bedingt. So ist die Zahl der Gedanken gleich der Zahl der Substanz. Deshalb sagen wir nicht mit unseren Vorfahren:
Unsere Welt ist die Welt der Tat, die auf unterster Stufe der ergossenen Heiligkeit liegt.
Читать дальше