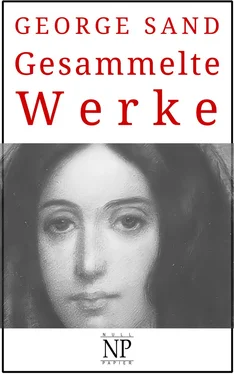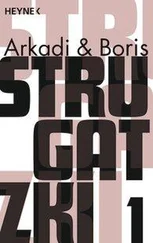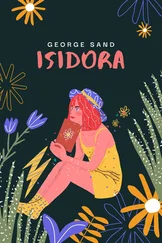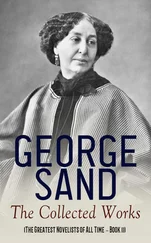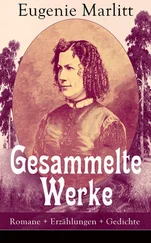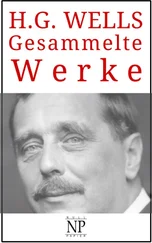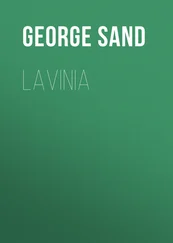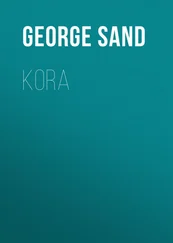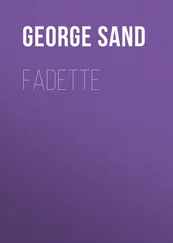George Sand - George Sand – Gesammelte Werke
Здесь есть возможность читать онлайн «George Sand - George Sand – Gesammelte Werke» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:George Sand – Gesammelte Werke
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
George Sand – Gesammelte Werke: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «George Sand – Gesammelte Werke»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
George Sand – Gesammelte Werke — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «George Sand – Gesammelte Werke», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Aufmerksamkeit und Spannung, womit sie ihm zuhörte, der helle Verstand, der in den großen Augen dieses lernbegierigen, mit Fassungskraft und Sinn für jeden hohen Gedanken begabten Mädchens blitzte, trieben Rudolstadt zu einer allmählich immer lebendigeren Anschauung und Überzeugung von dem was er sagte, fort, und seine Beredsamkeit wurde immer ergreifender.
Nach einigen Einwürfen, welche er glücklich zu beantworten wusste, dachte Consuelo an nichts mehr, als die ihr natürliche Wißbegierde zu befriedigen, und dieser Trunkenheit der Bewunderung zu genießen, die ihr Albert abgewann. Sie vergaß alles, was sie den Tag über aufgeregt hatte, alles, Anzoleto, Zdenko, die Gebeine vor ihren Augen. Sie war wie bezaubert, und der fantastische Ort, an welchem sie sich befand, mit seinen Cypressen, seinen düsteren Felsen, und dem schauerlichen Altar, erschien ihr im zitternden Lichte der Fackeln wie ein magisches Paradies, in welchem hohe, feierliche Gestalten auf und nieder wogten. Sie versank, obgleich wach, in eine Art Erstarrung aller Kräfte des Bewusstseins, welche sie ein wenig zu sehr für ihre erregbare Fantasie in Anspannung erhalten hatte.
Sie hörte nicht mehr was Albert sprach, sondern in Wonnen der Verzückung schweigend, hing sie dem Bilde dieses Satans nach, den er ihr als einen großen verkannten Gedanken vorgestellt hatte und den ihre künstlerische Seele sogleich als eine schöne, bleiche, leidende Gestalt anschaute, der Christi ähnlich und sanft zu ihr, einem Kinde des Volkes, einem verstoßenen Kinde der allgemeinen Familie niedergebeugt.
Plötzlich bemerkte sie, dass Albert nicht mehr mit ihr sprach und ihre Hand nicht mehr in der seinigen hielt, dass er nicht mehr neben ihr saß, sondern zwei Schritte von ihr, vor dem Schädelaltare stand und auf seiner Geige die seltsamen Weisen spielte, welche sie schon früher ergriffen und entzückt hatten.
Ende des vierten Teils.
Anmerkung des Übersetzers
über die Entwicklung der Vorstellungen vom Teufel.
George Sand schreibt nur für Leserinnen; wenigstens redet George Sand immer, wenn er sich an seinen Leser wendet, die Leserin an. Ich erschrecke; denn ich habe schon wieder die Feder angesetzt zu einem – gelehrten Exkurse. Gütige Leserin, Verzeihung! Es ist so leicht, diese Anmerkung zu überschlagen: sie ist ja nicht umsonst in Petit gesetzt. Aber ich kanns nun einmal nicht lassen, wenn solche Sachen vorkommen, die gleichsam in mein Fach einschlagen, ein wenig mit drein zu reden. Und zum Dank für sonstige Bemühung und guten Willen mögen Sie mir immerhin das unschuldige Vergnügen gönnen, freundliche Leserin, etwas zu schreiben, was Sie nicht zu lesen brauchen, weil Sie ja schon aus der Überschrift ersehen, was Sie zu erwarten haben.
Sie merken übrigens – es hülfe ja nichts, nicht ehrlich sein zu wollen – dass ich mir vorstelle, wie Sie, trotz der Überschrift, doch ein wenig in die ersten Zeilen hineingucken und dass ich im Stillen mir schmeichle, Sie sacht noch ein Stückchen vorwärts zu locken. Glückt das, so entschuldige ich mich weiter so:
Eingelassen hat sich unser Verfasser nun einmal auf die höchsten und tiefsten Fragen und hat versucht, die im Verlaufe der Zeiten entstandenen Lösungen derselben geschichtlich zu entwickeln und aus den Eigenheiten der Menschennatur zu erklären. Wessen Geist sich dadurch angereizt fand, sollte der nicht Lust haben, auch noch etwas tiefer einzudringen?
Albert fuhr fort, hieß es oben im Texte, seiner aufmerksamen Zuhörerin den tiefen Sinn der Wahrheiten, die man Ketzerlehren genannt hat, aufzuschließen. Sollte nicht manche wissbegierige Consuelo unter unsern Leserinnen sein, welche bedauert, dass es dem Verfasser nicht gefiel, auch das, was Albert weiter sagte, wirklich mitzuteilen?
Doch, wie dem sei, George Sand hat den Teufel an die Wand gemalt: es wundere sich daher niemand, dass er den Hals jetzt auch user den Rahmen hinausreckt.
Es ist wahr, dass der Teufel eine monströse Schöpfung Gottes wäre, wenn Gott ein Wesen geschaffen hätte, um die göttliche Arbeit, über die sich Gott, laut der Genesis, freute, weil sie so gut war, zu verderben. Aber woher kommt denn doch das Übel und das Böse, wenn Gott alles gemacht hat, und Gott über alles Macht hat, und, weil er vollkommen gut ist, nur Gutes machen und dulden kann? So gar leicht ist nicht da herauszukommen; denn hat das Gute seine Ursache, die es wirkt, nämlich Gott, so will natürlich auch das Böse seine Ursache haben, die es wirkt. Nein, so leicht ist nicht aus der Sache zu kommen.
Es ist wahr, dass die Vorstellung vom bösen Prinzip, das mit dem göttlichen und guten Prinzip in Feindschaft liegt, eine kindliche Vorstellung ist, aber diese kindliche Vorstellung haftet doch noch bis auf den heutigen Tag der Welt an, die ihre Kinderschuhe längst vertreten hat, und es ist auch nicht zu leugnen, dass auf den mannigfaltigsten Bildungsstufen des menschlichen Geistes dieselbe Vorstellung immer wieder und in den mannigfaltigsten, oft künstlichsten Formen sich geltend gemacht und den scharfsinnigsten und größten Geistern unter den Menschen sich immer wieder aufgedrängt hat.
Es wäre immer sonderbar, dass eine Vorstellung, die, vermöge ihrer kindischen Natur, nur der Kindheit des Menschengeschlechts eignen sollte, sich durch die Reife der Zeiten und der Geister so unwiderstehlich hat hindurchkämpfen können. Aber ich will doch gleich von vorn herein sagen, warum ich es dessenungeachtet richtig finde, sie eine kindliche Vorstellung zu nennen. Weil das Kind nicht fähig ist, die allgemeinen Mächte des Lebens in ihrem gesetzmäßigen, ewig unveränderlichen Wirken zu begreifen, sondern, wo es etwas gewirkt sieht, stets vermutet, dass die Wirkung von dem willkürlich wirkenden Willen irgend einer Persönlichkeit ausgegangen sei.
Der Mensch empfindet zuerst das, was ihm wohl oder übel tut. Er weiß aus Erfahrung, dass er selbst jedem anderen und jeder andere ihm wohl und übel tun kann. Widerfährt ihm nun Gutes oder Schlimmes, dessen Urheber er nicht kennt, so schreibt er dasselbe einem ihm unbekannten Wesen zu oder auch einem anderen Menschen, der aber auf eine ihm verborgene Weise, durch außerordentliche Mittel das Geschehene bewirkt hat. Das eine ist der Glaube an Götter, das andere der Glaube an Zauberkunst.
Der Mensch findet in seinem Geiste den notwendigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Ist ihm der Gedanke der Notwendigkeit aufgegangen, so kann er das Gegenteil davon, den Gedanken der Zufälligkeit nicht ertragen. Der Blitz schlägt ein. Notwendig ist, dass der Blitz irgend wohin treffe. Der Mensch begreift aber nicht, warum der Blitz gerade in sein Zelt, in seine Hürde schlägt; zufällig kann dies nicht sein: es muss ihn irgend ein Wesen, dahin geleitet haben.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «George Sand – Gesammelte Werke»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «George Sand – Gesammelte Werke» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «George Sand – Gesammelte Werke» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.