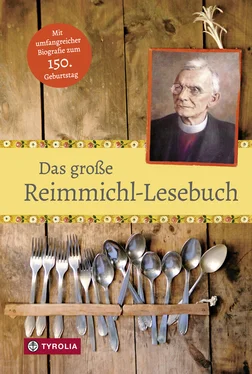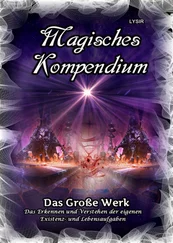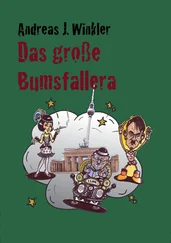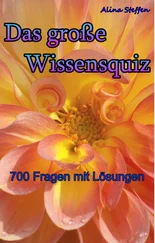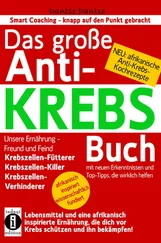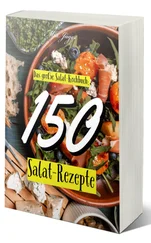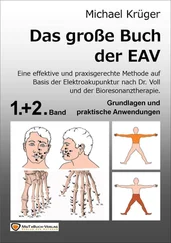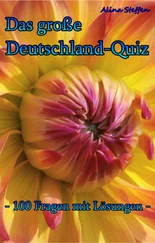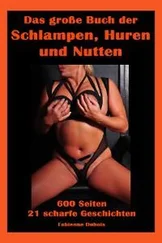Der zweite Aspekt: Die Kirche war im 19. Jahrhundert von den äußeren Feinden Liberalismus und Sozialismus ernsthaft bedroht: Beide waren antiklerikal und von missionarischem Eifer erfüllt. Ihr erklärtes Ziel war damals die Zurückdrängung der katholischen Kirche, in der sie ein Hindernis für den Fortschritt sahen. Kein Wunder also, dass sich die Kirche vehement gegen diese beiden Ideologien wehrte. Der Kampf wurde in Tirol auf mehreren Ebenen in aller Härte geführt: auf der politischen mit Hilfe christlich orientierter Parteien; von den Kanzeln, was Liberale und Sozialisten immer wieder wutentbrannt anprangerten, weil sie selbst über kein gleich wirksames Instrument verfügten, sowie schließlich über Zeitungen, zu denen auch der einflussreiche „Tiroler Volksbote“ zählte.
In den Jahren 1861 und 1867 wurde unter dem Einfluss liberaler Gruppen erstmals zwischen Kaiser und Reichsrat eine Verfassung vereinbart, die die Macht des Adels und der Kirche einschränkte, die Mitsprache des Volkes garantierte und bürgerliche Freiheiten brachte. Viele Errungenschaften, die heute für selbstverständlich gehalten werden, galten damals als unerhörte Neuerungen: der demokratische Gedanke, die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, die Unverletzlichkeit des Eigentums, das Briefgeheimnis, die Freiheit Vereine zu gründen und Versammlungen abzuhalten, Pressefreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit – freie Wahl der Religionszugehörigkeit –, Freiheit der Wissenschaft und Lehre, freie Berufswahl und Niederlassungsfreiheit u. a. m. Nun möchte man meinen, dass die Menschen damals alle diese Freiheiten, die ihnen der Staat ab nun garantierte, freudig begrüßt hätten. Doch nicht wenige Menschen lehnten viele dieser Freiheiten ab, denn sie meinten, statt der bisherigen Ordnung werde nun das Chaos Einzug halten, „wenn jeder Mensch tun und lassen kann, was er will“ – so die vielfach gehörte Interpretation der neuen Freiheiten.
Von größter Bedeutung war das nunmehr garantierte Versammlungsund Vereinsrecht. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, Interessensvereinigungen zu gründen. Es entstanden zahlreiche Kultur- und Bildungsvereine. In deren Versammlungen wurden auch soziale sowie gesellschaftliche Probleme und deren Lösung diskutiert. Daraus entstanden politische Vereine. Unterschiedliche Argumente und Weltanschauungen führten dann zur Herausbildung von unterschiedlichen politischen Gruppierungen: Dem liberalen stand das katholisch-konservative Lager gegenüber – noch immer in Form von Vereinen. Erst ab 1880 formierten sich dann in den größeren Städten aus diesen politischen Vereinen die liberale und die konservative Partei. Die Sozialdemokratische Partei Tirols wurde erst 1890 gegründet, wurde aber in Tirol nie zu einer bestimmenden Kraft.
Die Liberalen griffen vor allem auf die Ideen der Aufklärung zurück, die sich ab etwa 1700 entwickelten. Immanuel Kant (†1804) fasste zusammen, worum es bei der Aufklärung geht: „Aude sapere! Habe Mut, fange an, dich deines eigenen Verstandes ohne Bevormundung durch andere zu bedienen!“ Der Mensch sollte nicht blind weltlichen und geistlichen Autoritäten folgen – gemeint waren in erster Linie Adel und Kirche –, sondern selbst den Verstand gebrauchen und vernünftig handeln. Damit geriet die Aufklärung in schroffen Gegensatz zum Christentum, das einen geoffenbarten und keinen „Verstandes“-Glauben verkündete. Die Aufklärung bedeutete nun für die Kirche die größte Gefahr und entsprechend hart waren die Auseinandersetzungen und Abwehrkämpfe.
Der Liberalismus entwickelte sich auch in Tirol vorwiegend in den Städten und Märkten sowie an der Universität. Teile des Adels, der Beamten und besser Gebildeten waren seine Anhänger. Er zerfiel von Anfang an in mehrere Richtungen. In einigen Punkten aber herrschte Einigkeit: keine Vorherrschaft mehr durch Adel und Geistliche; man war gegen föderalistische Bestrebungen und für einen starker Zentralstaat; für eine freie Wirtschaft ohne staatliche Hemmnisse; für den Ausbau des Rechtsstaates sowie der bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte im Sinne der Aufklärung.
Die Christlich-Konservativen, die vor allem die Landbevölkerung hinter sich hatten und im Tiroler Landtag die überwältigende Mehrheit besaßen, wandten sich entschieden gegen diese Forderungen der Liberalen. In keinem wichtigen Punkt gab es Übereinstimmung. Die Tiroler Gegenargumente waren: Adel und Kirche waren seit Jahrhunderten Garanten der Ordnung in der Gesellschaft; das Ständewesen, in dem jeder seinen Platz hat, bewährte sich; die ungezügelte Freiheit und Gleichheit, wie sie die Demokratie versprach, sei gegen die göttliche Ordnung. Außerdem hätte Tirol seit Jahrhunderten verbriefte Sonderrechte und „angestammte Freiheiten“, die es unter keinen Umständen aufgeben würde. Eine Wirtschaft ohne staatliche Regulierung sei abzulehnen. Sie ginge nur zu Lasten der Tiroler Landwirtschaft sowie der Klein- und Mittelbetriebe. Von einer freien Wirtschaft würden nur die in- und ausländischen „Geldsäcke“ profitieren.
Ein weiterer überaus wichtiger Punkt für den Landtag war die Sicherstellung der Glaubenseinheit: Tirol ist seit jeher ein geschlossen katholisches Land, wurde argumentiert, und seine Religion ist Garant für Friede und Wohlergehen der Heimat. Außerdem hätte der Tiroler Landtag 1796 mit dem Herz-Jesu-Gelöbnis die Treue zu Gott und zum Erbe der Väter ausdrücklich beschworen. Deshalb könnte es in Tirol auch keine andere offizielle Religion geben als die katholische. Die Kurzformel lautete: Glaubenseinheit = Landeseinheit.
Die Auseinandersetzungen zwischen dem konservativen Tirol und der liberalen Zentralregierung erreichten mit der Durchführung verschiedener Gesetze ihren Höhepunkt:
Der erste große Aufreger war die Verstaatlichung der Schule ab 1867. Worum ging es? Es war eines der Ziele der Liberalen, die Macht des Klerus zu brechen. Sein großer Einfluss auf die Bevölkerung war ihnen ein besonderer Dorn im Auge.
Die Kirche hatte damals aus historischen Gründen nahezu das Bildungsmonopol. Also verstaatlichte die Regierung das Schulwesen, wandelte die Volksschule in eine achtjährige Pflichtschule um, die ausnahmslos alle Kinder besuchen mussten, machte die Lehrer zu öffentlich Bediensteten und übernahm die volle Aufsicht, sodass der Kirche nur noch die Kontrolle des Religionsunterrichtes blieb. Die Empörung über dieses Schulgesetz war groß und erfasste auch weite Teile der Tiroler Bevölkerung. Man war überzeugt, dass nur die Kirche sicherstellen könnte, dass Kinder zu charakterlich und religiös gefestigten Menschen und nützlichen Mitgliedern der Gemeinschaft herangebildet würden. Der Streit um die Schule zog sich jahrelang hin.
Nächster Streitpunkt war die Gleichstellung der Protestanten mit den Katholiken. Eigentlich war diese Frage bereits mit dem Toleranzpatent Kaiser Josephs II. aus dem Jahre 1781 entschieden worden. Durch dieses erhielten die Protestanten das Recht der freien Religionsausübung, wobei der katholischen Religion eine Vorrangstellung zugebilligt blieb. Aber Tirol hatte sich mit Erfolg gegen diese neuen Bestimmungen gestemmt und unter Verweis auf die Glaubenseinheit des Landes Ausnahmeregelungen durchgesetzt. Jetzt aber bekräftigte die liberale Regierung nochmals die Gleichstellung und verband damit für die Protestanten die Erlaubnis, eigene Pfarren zu gründen, Kirchen (mit Kirchturm) zu bauen und ihren Kult öffentlich auszuüben. Gegen den Willen und unter Protest des Tiroler Landtages wurden dann 1876 in Innsbruck und Meran die ersten evangelischen Gemeinden Tirols gegründet.
Als dritte Ungeheuerlichkeit wurden die staatlichen Kirchengesetze 1868 empfunden. Sie ersetzten das kanonische Eherecht der Kirche, das bisher von Staats wegen für Ehen zuständig war, durch ein neues staatliches Eherecht. Ab nun waren in eingeschränkter Form auch Ziviltrauungen und Scheidungen möglich. In diesen sogenannten Maigesetzen wurden auch die Verhältnisse in gemischten Ehen (z. B. Ehen zwischen Katholiken und Protestanten und die Erziehung der Kinder aus diesen Ehen) neu geregelt.
Читать дальше