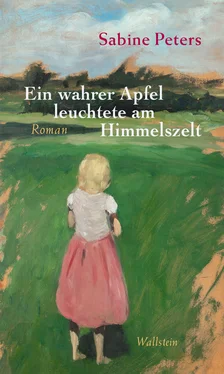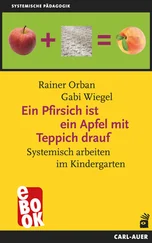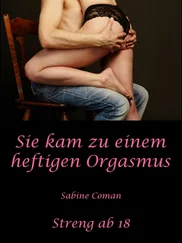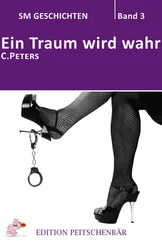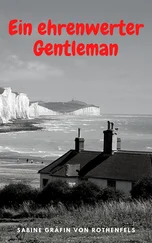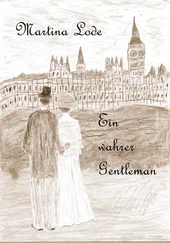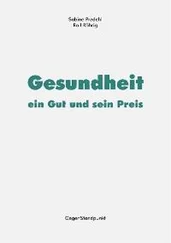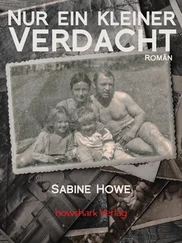Marie stach sie in den Bauch, dann hob sie den Finger und rief: Kauen, Schlucken! Einfache Übung! Katrin sagte, Pupsmann.
Beim Mittagessen galt die Anstandslöffelregel nicht für Kinder, wenn es Niere, Leber, Herz und anderen Innereien gab.
Das Kartoffelpüree war ein Burgberg, in dem der Burgherr Möhrenprinzen gefangen hielt. Braune Linsensuppe kam aus einem dunklen Wald, an dessen Rand ein Moor lag, sie gehörte zum Land der Verruchten. Kartoffelklöße waren freundliche Riesenfrauen. Spargel schmeckte nach Wasserleiche, nach toter Jungfer. Die Gabel stakste durch den Urwald aus grünem Salat, pickte nach Schnittlauch, schnitt eine zitronensaure Fratze und spritzte vor Freude. Gekochte Erbsen nannte Vater lästiges Kindergesocks, er mochte lieber Erbsenmus, das lag auf den Tellern als matter Schlamm. Der Pfannkuchen rannte kantapper kantapper davon: Bin ich nicht schon dem Hasen und dem Wolf entkommen? Marie mochte ihn gern, obwohl er nicht rennen und rollen sollte. Sie hätte sich ihn gern auf den Kopf gelegt, als Heiligenschein. Die Blutwurst war vom falschen Glitzerspeck verflucht, vor Trauer schwarz, und wer sie aß, erlöste sie. Der Schellfisch lag in einem ovalen schwarzweißen Boot und schämte sich, wenn ihm die Silberhaut vom Leib geschnitten wurde und in feuchten Fetzen dalag. Reibekuchen waren niederes, stinkendes, rohes Gesindel, das man nur in der Küche aß. Reibekuchen waren, sagte Vater, manchmal Schwärzlinge, sie trotzten und schrien und brannten. Nudeln aßen sich von selbst und lagen sanftmütig im Bauch. Blumenkohl stank. Chicorée war bitter, aber die Eltern hatten in der Kriegszeit Giersch gegessen und sich nicht beklagt. Bratwürstchen rutschten im Hals zwar runter, aber sie wollten gleich wieder rauf. Gefüllte Paprika waren scharfe Chinesen, die Schlitzaugen machten. Die Frikadellen hatte Vater umbenannt, sie hießen Teigwaren, weil Mutter das Fleisch mit zu vielen Brotresten streckte.
Man schlug mit seinem Löffel auf den Wackelpudding ein und sagte: Zittre nicht, ich fress dich doch. Das Apfelkompott teilte man sich in Viertel, ließ den Löffel über jedes Viertel wandern und sagte dazu: Dich-es-se-ich-zu-erst-auf. Dann nahm man eine Löffelspitze. Man arbeitete sich langsam, aber stetig vor, bis aller Nachtisch weg war.
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du unser Gast gewesen bist, Amen.
Danach durfte eines der Kinder die große Tonne aus der Küche bringen, wenn nicht Advents- oder Fastenzeit war. Die große Tonne war eine schwarzrote blumengemusterte Dose aus Blech. Darin gab es Schokolade, Lakritzkatzen und Gummibären und man versuchte mit Mutter zu handeln, denn ein Stück Schokolade war mehr wert als ein Getier. Vater sagte zu den Kindern, ihr seid dumme Krämerseelen. Aber er handelte selbst mit Mutter, führte gewundene kluge Reden und stahl unterdessen.
Der Schutz der Großmutter
Mamatschi lag mit geschlossenen Augen auf ihrem Bett. Ihre Daumen drehten sich. Marie stand auf dem Sessel, sah aus dem Fenster. Man hatte einen Überblick den ganzen Hügel runter, sah Rübenfelder, die Straße, auf der Weide daneben grasten Bauer Weilers Kühe. Marie spielte Autos zählen, aber es fuhr kaum eines den Hügel rauf oder runter. Fünf, sagte sie schließlich.
Sie holte Mamatschis Pantoffeln und ließ sie als Autos über die Fensterbank fahren. Sie knibbelte am Holzlack des Fensterrahmens. Puhlte an dem kleinen Loch der Kopfstütze des Sessels. Sah eine Fliege, die wieder und wieder gegen das Fenster dotzte. Sie nahm eines von Mamatschis Haarnetzen und schnupperte. Ein bitterer Geruch. Sie spannte das Netz, um die Fliege zu fangen, aber die ging nicht rein. Sie spielte mit sich selbst das Spiel von Taler, Maler, Kühchen, Gänschen, Ränzchen, Killewänzchen. Schließlich sah sie sich nach der Großmutter um: Schläfst du? Mamatschi sagte, ich ruhe. Aber das Daumendrehen hatte aufgehört.
Draußen ging die Wandergrete mit schnellen festen Schritten den Hügel herunter. Immer war sie auf den Straßen unterwegs, lief von Dorf zu Dorf, so war es, so würde es bleiben. Vater nannte sie unsterblich. Die Wandergrete war vielleicht so alt wie Großmutter, vielleicht auch nicht. Sie wirkte unheimlich, obwohl sie immer lächelte. Das war, weil ihr Gesicht aus Holz gemacht war.
Eine Fliege landete auf dem Kinn der Großmutter, sie schlug danach und öffnete die Augen. Mamatschi, bat Marie, bitte lies mir vor. Draußen kommen keine Autos.
Die Großmutter sah nach der Uhr, setzte sich langsam auf.
Marie zog ihr die Pantoffeln an, die eben noch Autos gewesen waren.
Mutter kam ins Zimmer, brachte Mamatschi eine Tasse Kaffee und Marie ihre Puppe Lieschen. Ihr drei passt gut aufeinander auf, ich fahre jetzt mit Katrin in die Stadt, sagte sie. Dass ihr mir kein Theater macht.
Vater war im Auto unterwegs mit Barbara und Jutta, sie suchten nach Spuren der alten Römer. Er schrieb darüber Aufsätze für Zeitschriften. Sein Beruf hieß freier Journalist. Vorher war er beim Eisenwalzwerk Rasselstein bei wertvollen alten Papieren gewesen, sein Raum hieß Archiv. Aber dann fand er, sein Chef war ein dummer Frühstücksdirektor und die Arbeit für ihn ein Dreck ohne Ende. Er hatte den Dreck gefeuert und folgte lieber den Römern. Jutta und Barbara mussten oft mit ihm fahren, auch wenn sie nicht wollten.
Mutter verschwand mit Katrin auf der Dorfstraße in Richtung Bushaltestelle.
Marie sah, wie der Bus den Hügel runterfuhr und winkte ihm nach. Sie streichelte den Gummibaum. Sie saß mit Lieschen im Sessel und fand es zu still im Zimmer. Mamatschi sagte, Courage. Du wirst schon sehen, die anderen kommen wieder. Sie gab Marie zur Beruhigung ein Stück Schokolade, griff nach einem Buch und setzte sich in ihrem Sessel zurecht. Sie trank einen Schluck Kaffee, schloss die Augen, schlug das Buch aufs Geratewohl auf. Sechzehnter Oktober, rief sie, der Tag meiner Namenspatronin! Wo ist meine Brille?
Beide kannten die Geschichte beinahe auswendig. Marie ließ ihre Puppe Purzelbäume schlagen, hörte der Großmutter zu: Die heilige Hedwig war eine Grafentochter und ging schon als Kind in ein Kloster. Dort lebten fromme Nonnen, die sie erzogen. Hedwig war noch jung, gerade zwölf Jahre alt, da wurde sie verheiratet. Der Herzog ging mit ihr nach Schlesien, das liegt im fernen Osten, im Herrschaftsgebiet der Kommunisten. Hedwig schenkte sieben Kindern das Leben und musste doch manche verlieren. Aber sie lobte Gott und klagte nie. Nach zweiundzwanzig Jahren Ehe lebten sie und ihr Mann enthaltsam. Sie gründeten eine Abtei. Hedwig half den Armen, wo sie konnte. Sie kasteite sich, das heißt, sie ging im Winter barfuß. Da ermahnte sie der Bischof, du musst Schuhe tragen. Mamatschi fragte, warum wohl? Lieschen schlug den Purzelbaum rückwärts. Hedwig holt sich barfuß im Schnee den Tod, sagte Marie. Mamatschi fragte, und was tat die heilige Hedwig? Sie gehorchte, trug die Schuhe, aber in der Hand. Marie hatte diesen Teil der Geschichte noch nie verstanden. Gab Hedwig ihre Schuhe nicht den Armen? Mamatschi sagte, hier steht nur, sie machte sich den Armen gleich. Marie stand auf und sah im Buch das Bild der verschleierten Frau, sie hatte einen gelben Reifen um den Kopf, das Zeichen ihrer Heiligkeit, und sie hielt Schuhe in der Hand. Lieschen verliert ihre immer, sagte Marie, die sind ihr zu groß.
Sie blätterte im Buch der Namenspatronen. Viele waren Märtyrer, die hatten ihr Blut für den Herrn Jesus gegeben. Bunte Bilder, Stephanus wurde gesteinigt, Sebastian durchbohrt von Pfeilen, die er vorerst überlebte. Maria war die Königin der Märtyrer, obwohl sie ganz natürlich starb und dann sofort, ganz ohne Prüfung und Gericht, in Gottes Reich einging. Sie hatte zwar keine Schläge und Wunden am Leib empfangen. Aber ein scharfes Schwert des Schmerzes hatte ihr die Seele zerfetzt. Das war, als sie erleben musste, wie ihr Sohn den Kreuztod duldete, um die Menschen zu retten.
Читать дальше