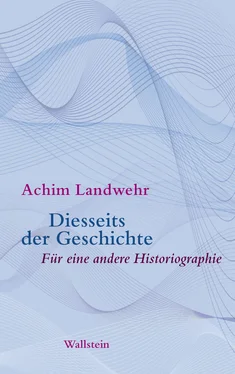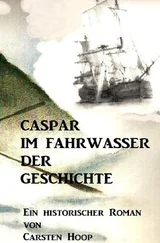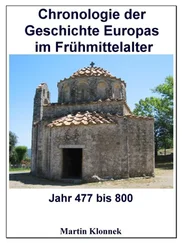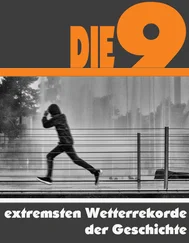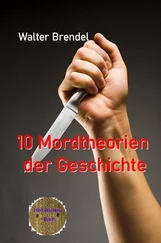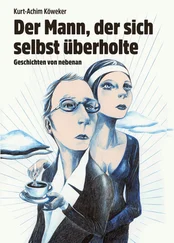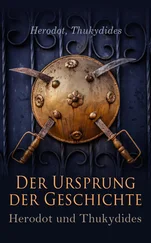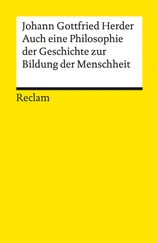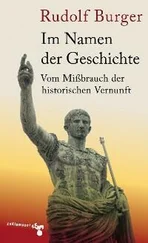Auch das Reden und Denken in den Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deckt wahrlich nicht alle Zeiten ab, die uns vielzeitig zur Verfügung stehen. Aufgrund ihrer unübersehbaren Bedeutung lohnt eine zumindest probebohrende Beschäftigung damit aber allemal. Dabei muss auch der Kontingenz der Vergangenheit (wieder) ein angemessener Platz eingeräumt werden. Sind wir üblicherweise nur gewillt, der Zukunft zu attestieren, kontingent zu sein, also die verunsichernde Eigenschaft zu besitzen, sowohl möglich als auch nicht möglich sein zu können, sollte man das Un / Mögliche des Vergangenen doch nicht übersehen. Gerade vor der Erwartung, Hort der sicheren und nicht mehr veränderbaren Gewissheit zu sein, muss man das Historische beschützen. Denn sollte die These von der Vielzeitigkeit plausibel sein, dann müssen Gegenwarten nicht nur beständig damit rechnen, von Unwägbarkeiten der Zukunft überrascht zu werden, sondern dann werden sie auch von Gespenstern aus der Vergangenheit heimgesucht, deren Existenz sie nicht einmal zu erträumen wagen und die bis zu ihrem Auftauchen in einem wörtlichen Sinn als undenkbar gelten – und zwar sowohl im Positiven wie im Negativen. Spätestens hier zeigen sich die Restriktionen einer Geschichtsauffassung, die auf Homogenität, Linearität und Teleologie setzt, weil mit ihr tendenziell all die möglichen Geschichten beiseite gedrängt werden, welche die Vergangenheit immer noch bereithält. Wie sehr eine Gegenwart von solchen kontingenten Vergangenheiten überrascht werden kann, zeigt sich an der allfälligen Rede von den ›vergessenen‹ oder ›verschütteten‹ Geschichten, die erst und gerade jetzt wieder ins Bewusstsein gerückt werden.
Dieser Gegenwart kommt eine besondere Rolle im verwirrenden Spiel der Zeiten zu. Schließlich ist sie die einzige Zeit, die uns zur Verfügung steht – und sie ist auch als Zeitmodalität dadurch gekennzeichnet, das Verfügbare zu umfassen, also alles das, was noch beeinflusst und verändert werden kann. Die Gegenwart beinhaltet auch die jeweils verfügbaren Vergangenheiten und Zukünfte, weil diese abwesenden Zeiten keinen anderen Existenzort haben – schließlich sind sie als Vergangenheiten nicht mehr und als Zukünfte noch nicht. Aufgrund dieser Bedeutung muss es verwundern, dass ›Gegenwart‹ generell eher wenig behandelt wird. Vielleicht aufgrund der überbordend erscheinenden Aufgabe, damit eigentlich schon alles behandeln zu müssen?
Um der erdrückenden Komplexität zu entgehen, alles gleichzeitig behandeln zu müssen, können Phänomene und Probleme in abwesende Zeiten abgeschoben werden. Vergangenheit und Zukunft sind daher auch die Zeiten des Nicht-mehr beziehungsweise des Noch-nicht. Paradoxerweise können Vergangenheiten und Zukünfte diese Rolle aber nur übernehmen, wenn sie als abwesende Zeiten beständig anwesend gehalten werden. Damit ist aber auch klar, dass Vergangenheit und Zukunft keine Zeiträume sind, die der Gegenwart dichotomisch gegenübergestellt werden können, sondern temporale Projektionen einer Gegenwart, die sich niemals von dieser Gegenwart ablösen lassen ( Zukunft – Sicherheit – Moderne ). Nicht zuletzt die allfälligen politischen Verknüpfungen von Zukunftsfragen mit Sicherheitsproblemen zeigen jedoch die Schwierigkeiten, die sich ergeben, sobald eine künftige Zeit als vermeintlich unabhängige Wesenheit von der sie entwerfenden Gegenwart abgekoppelt werden soll. Dann handelt es sich um den kaum verschleierten und zwangsläufig zum Scheitern verurteilten Versuch einer Stillstellung von Zeit.
Dass die zeitlichen Verhältnisse so viel komplexer sind, als wir üblicherweise annehmen, verdeutlichen nicht zuletzt temporale Phänomene, die übersehen, nicht ernst genommen oder schlichtweg abgelehnt werden. Kulturelles Vergessen sieht sich beispielsweise gegenüber der Erinnerung und dem Gedächtnis noch immer in einer Rechtfertigungsposition. Dabei ist das Vergessen nicht nur ebenso lebensnotwendig wie das Erinnern, sondern zeichnet sich auch durch zahlreiche zeitliche Verwicklungen aus. Während man einerseits vergessen muss, um Leben überhaupt noch zu gewährleisten, ist andererseits Vergessen im strengen Sinn unmöglich, weil man sich zumindest noch daran erinnern muss, vergessen zu haben. Zudem führt uns das Vergessen zurück zur Kontingenz der Vergangenheit, denn damit wird man nicht nur verwiesen auf Gewesenes, das verdrängt worden ist, sondern auch auf die Erinnerungen an Geschehnisse, die nie stattgefunden haben. Das Vergessen macht also aufmerksam auf die Potentialität des Historischen: Dort schlummern Vergangenheiten in der Inaktualität, die unerwartet gegenwärtig werden können.
Eine bekannte rhetorische Formel, um die Vielzahl historischer Verzeitungen auf einen Nenner zu bringen, ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen . Auch wenn die Intentionen, die sich mit dieser Formel verbinden, durchaus lauter sein mögen, ergeben sich damit doch unschwer zu erkennende Schwierigkeiten. Die Rede von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bleibt letztlich einem Euro- und Chronozentrismus verhaftet, den sie auf den ersten Blick zu überwinden versucht. Aber solange jede Feststellung einer Ungleichzeitigkeit – versehen mit diesem negativen Präfix ›Un-‹ – immer nur vorgenommen werden kann, weil sich das sprechende Subjekt selbst eine Position der Gleichzeitigkeit attestiert, lässt sich der Falle des Chronozentrismus nicht entkommen. Auch hier bedarf es einer tatsächlichen Behandlung der Gleichzeitigkeit der Zeiten.
Wird das Vergessen tendenziell übersehen und die Ungleichzeitigkeit missverstanden, so wird der Anachronismus nicht selten schlicht abgelehnt. Er wird zu den geschichtswissenschaftlichen Todsünden gerechnet – obgleich sowohl die Feststellung von Anachronismen wie auch das geschichtswissenschaftliche Arbeiten selbst immer schon anachronistisch sind. Denn erst in einer Kultur, die sich selbst einer strengen Chronologie verpflichtet hat, kann die Rede von einem chronologischen Einordnungsfehler sinnvoll sein – und das war in Europa vor dem späten 16. Jahrhundert offensichtlich nicht der Fall. Alle zuvor erfolgten Anachronismen können also noch gar keine gewesen sein. Und seither sind wir die Anachronismen auch nicht losgeworden – zum Glück. Denn historisches Arbeiten heißt ja gerade nicht, der eigenen Gegenwart eine von ihr abgetrennte Vergangenheit dichotomisch gegenüberzustellen, um eindeutig über sie zu urteilen, sondern heißt Relationierungen vorzunehmen, um abwesende Zeiten anwesend zu halten. Das kann gar nicht ohne anachronistische Vermischungen vor sich gehen. Das sollte aber auch nicht ohne solche Vermischungen vor sich gehen, denn der Anachronismus wirkt im höchsten Maß historisch produktiv.
Wenn ich aber nun so ausgiebig von den Unzulänglichkeiten etablierter Zeit- und Geschichtsmodelle gesprochen habe, um stattdessen die Vielzeitigkeit und die Relationierung der Zeiten zu betonen – wie kann und soll dann Geschichtsschreibung aussehen? Wie können wir gerade unter Umständen, die sich selbst als unübersichtlich, verunsichert und ungewiss beschreiben, eine Form der Historiographie betreiben, die sich nicht auf die Jenseitigkeit eines Kollektivsingulars Geschichte verlässt, sondern sich mit der Diesseitigkeit des Historischen begnügt? Mein Vorschlag hört auf den Namen Chronoferenzen . Damit soll es möglich werden, die homogene Linearität des Kollektivsingulars Geschichte zurückzulassen, um stattdessen die wesentlich vielfältigeren und allenthalben auffindbaren Möglichkeiten und Praktiken zu behandeln, anwesende mit abwesenden Zeiten zu koppeln. Dadurch ergibt sich zugegebenermaßen ein deutlich komplexeres Bild der zeitlichen Verhältnisse, in denen wir leben, das ich mit dem Begriff der ›Zeitschaft‹ zu fassen versuche. Dieser Komplexität ist nicht zu entkommen, denn selbst wenn wir es wünschen sollten, werden uns die Zeiten nicht den Gefallen tun, sich hübsch aufgeräumt in Reih und Glied aufzustellen. Und wenn wir zudem den Fragen und Problemen gerecht werden wollen, die uns in unserer Welt umtreiben, dann ist dafür ein angemessenes Verständnis der zeitlichen Relationierungen zwar nicht allein hinreichend, aber als Teil möglicher Antworten unabdingbar. Bei dieser Herausforderung helfen nicht neue Erzählungen im alten Gewand, sondern benötigen wir neue Erzählweisen, um diese Komplexität auf andere Art und Weise vorzuführen.
Читать дальше