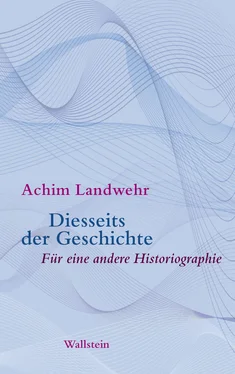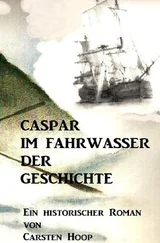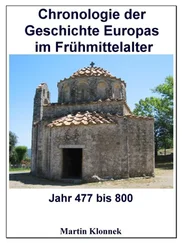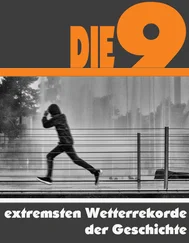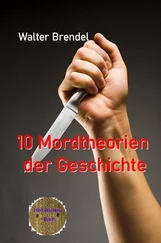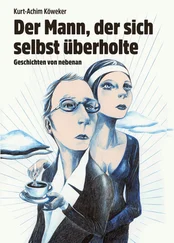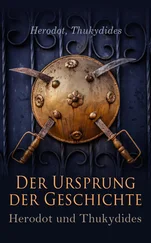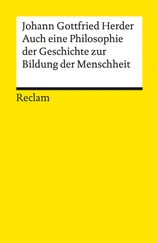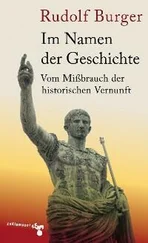Was aber ist hier zu lernen? Der Blick aus dem Fenster, der Gang auf der Straße oder das nachrichtenmäßige Verfolgen aktueller Geschehnisse in der Nähe und Ferne mag einem das bereits angedeutete große Durcheinander nahelegen. Dessen Hintergrund aber sind tiefgreifende Irritationen über Identitäten, Räume und Zeiten: Wer sind wir eigentlich? Wo befinden wir uns überhaupt? Und ganz wichtig: Wann sind wir? In einem Diskussionszusammenhang, der sich nur noch mit Schwierigkeiten als ›Europa‹ oder ›die westliche Welt‹ bezeichnen lässt, sind schon seit längerer Zeit solche und ähnliche Fragen zu vernehmen. Diese Fragen sind wahrlich nicht neu, selbst wenn es denjenigen so vorkommen mag, die sie gerade stellen.
So lässt sich nicht mehr gar so einfach von Europa und westlicher Welt sprechen, weil nicht mehr eindeutig ist, was damit gemeint sein könnte. Die Grenzen dieser diffusen geographischen Einheiten waren schon immer schwer zu bestimmen (Wo sind die Grenzen Europas? Was kann man noch / schon / nicht mehr zum Westen zählen?), aber Entwicklungen und Diskussionen, die wir etwas hilflos als Globalisierung und Postkolonialismus bezeichnen, haben diese Probleme nochmals deutlicher werden lassen. Wie nicht zuletzt Migrations- und Grenzsicherungsdebatten zeigen, versuchen sich erhebliche Teile Europas und der westlichen Welt gegen solche Diffusionen abzuschotten.
Im frühen 21. Jahrhundert scheint aber nicht nur die Bestimmung schwerzufallen, wo und wie wir sind, sondern es ist auch nicht mehr so einfach zu sagen, wann wir sind. Die verwirrenden Verwendungen und Diskussionen der Moderne, Postmoderne, Post-Postmoderne, Hypermoderne, Altermoderne und weiterer Kombinationen können davon Zeugnis ablegen. Die Behauptung geht einem nicht mehr leicht über die Lippen, man lebe in etwas, das sich als Moderne bezeichnen ließe. Und wieso überhaupt in der Moderne? Irgendetwas scheint daran nicht (mehr) zu stimmen. Bruno Latour hat bekanntermaßen formuliert, dass wir noch nie modern waren.[9] Wenn das aber stimmt, was waren wir dann die ganze Zeit? Wähnten wir uns über zwei Jahrhunderte lang in einem Zug durch die Zeit, ohne zu bemerken, dass es nur die Landschaft hinter dem Fenster war, die sich bewegte?
Es existieren aktuell zahlreiche Versuche, um das eigene Hier und Jetzt historisch-epochal einzuordnen: Man kann sprechen vom Zeitalter der Globalisierung, vom digitalen Zeitalter, vom Informationszeitalter, vom Anthropozän. Aber wird es diesen historischen Selbstbestimmungen besser ergehen als anderen epochalen Beschreibungen, die auch noch nicht sonderlich alt sind, aber von niemandem mehr benutzt werden? Oder wer erinnert sich noch an das Atomzeitalter, das Raketenzeitalter, das Maschinenzeitalter?
Die Unsicherheit hinsichtlich einer angemessenen Epochenbezeichnung nimmt sich nahezu harmlos aus angesichts solcher Schlagworte wie alternative Fakten, Fake-News oder post-truth . Reicht die Verunsicherung über unsere Wirklichkeit und ihre angemessene, gar wahre Beschreibung inzwischen schon so weit, dass es immer schwieriger wird, eine einigermaßen verbindliche Geschichte über diese Wirklichkeit zu schreiben? Oder noch schlimmer: Sind Verschwörungstheorien unterschiedlicher Couleur vielleicht nur die extremen Auswüchse einer Welt, in der sich jedes Kollektiv seine eigene Geschichte zusammenbasteln kann, wie es ihr gerade gefällt? Wenn wir keine großen Erzählungen mehr haben, können dann alle ihre eigene fabrizieren?
Auch in Sachen einer historischen Selbstbestimmung scheinen wir uns vor die Wahl zu stellen: Perfektion oder Weltuntergang? Große Ganzheit oder vollständige Zersplitterung? Die Welt entzieht sich uns, verweigert sich jeglicher Erfassung, auch und gerade die Welt in ihrer zeitlichen Verfasstheit. Lockt auf der einen Seite das Gewesene als Hort der Gewissheit, weil sich mit dem Blick ins Gestern doch eindeutig feststellen lassen sollte, was der Fall war (und immer noch ist), zeigt sich die Vergangenheit auf der anderen Seite als ausgesprochen flexibel, wenn es um neue Versionen ihrer selbst geht, ist geradezu aufnahmewillig für Anpassungen und Veränderungen (die von sich selbst aber regelmäßig behaupten, nun die endgültige und wahre Version zu sein). Auch wenn das Geschehene geschehen ist, wenn Schlachten nicht noch einmal geschlagen werden müssen, Revolutionen nicht noch einmal durchzufechten sind, Leben nicht noch einmal gelebt werden können und Tote nicht wieder auferstehen werden, haben wir doch die eigentümliche Eigenschaft, die Vergangenheit nicht ruhen lassen zu können, sondern immer wieder zu bearbeiten und immer wieder mit uns in Beziehung zu setzen. Und seltsamerweise verändert sich im Zuge dieser Bemühungen die Vergangenheit dann doch.
Provinzialität von Geschichte
Es ist aber gerade dieses In-Beziehung-Setzen mit der Vergangenheit beziehungsweise den vielen Vergangenheiten, das eine bereits angedeutete Ebene des Problems aufruft. Gerade weil es nicht mehr zu gelingen scheint, die Verbindungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit auf einen eindeutigen narrativen Nenner zu bringen, muss der Kollektivsingular Geschichte in Gänze in Zweifel gezogen werden. Es genügt eben nicht mehr, Reparaturen an diesem Modell vorzunehmen, es zu optimieren und an die aktuellen Verhältnisse anzupassen. Denn diese aktuellen Verhältnisse sind eben durch Verunsicherungen und Infragestellungen geprägt, die es verbieten, das Altbekannte in einer neuen Hülle als Lösung der Probleme anzubieten. In Zeiten religiöser oder ideologischer Weltbestimmungen gab es noch Angebote, um die langen historischen Linien zu ziehen. Aber diese großen Erzählungen haben schon seit geraumer Zeit ausgedient. Und selbst Jean-François Lyotard, der Schöpfer des Schlagworts vom Ende der großen Erzählungen, hat schon festgestellt, dass das Ende der großen Erzählungen auch schon wieder eine große Erzählung sei.[10]
Die größte aller großen Erzählungen ist aber ›die Geschichte‹ selbst. Der Kollektivsingular transportiert immer noch das Versprechen der Orientierung, der Identitätsbildung, der Absicherung, des tragenden Fundaments. Diese Zuschreibungen sollten ›der Geschichte‹ als einem angenommenen singularischen Superprozess nicht nur wegen der bereits genannten theoretischen Unzulänglichkeiten entzogen werden. Darüber hinaus ist die Vorstellung von einem Kollektivsingular Geschichte auch unzulänglich, weil sie Produkt eines europäischen Provinzialismus ist. Auch wenn diese Idee im Zusammenhang einer kolonialistischen und imperialistischen Dominanz Europas ihren Siegeszug um die ganze Welt angetreten hat und auch wenn diese Idee in bestimmten Kontexten durchaus produktiv wirken konnte, sind doch schon seit Längerem ihre Grenzen und Probleme offensichtlich. Denn die Verunsicherungen, Irritationen, Desorientierungen und Schwierigkeiten bei der Beschreibung unserer Welt rühren nicht zuletzt daher, dass es unter anderem der Kollektivsingular Geschichte ist, der uns bestimmte Denk- und Beschreibungsformen vorgibt, die so manches als undenkbar erscheinen lassen. Insbesondere bei der Berücksichtigung anderer, nicht europäischer Formen der Welterfassung und der Zeitorganisation wird die Begrenztheit dieses Modells von Geschichte deutlich. (Und bereits meine etwas hilflose Negativbezeichnung des ›Nicht-Europäischen‹ zeigt an, wie schwierig es ist, außerhalb der vorgebahnten Wege zu denken und zu schreiben, wenn sich dieses Außerhalb noch nicht einmal umstandslos positiv bezeichnen lässt.)
Man kann nicht nur feststellen, dass der Kollektivsingular Geschichte die ihm zugewiesene Aufgabe nicht mehr recht zu übernehmen vermag, sondern man muss vor allem feststellen, dass diese Idee von ›Geschichte‹ eine letztlich europäische Beschreibungs- und Erklärungsweise ist, die ihren Ursprungsort nicht zu verbergen vermag. Die Provinzialität von ›Geschichte‹ muss überwunden, der Kollektivsingular abgeschafft werden, um stattdessen die Vielfalt der Zeiten anzuerkennen. Was nicht mehr hinreichen kann, ist die endlose Wiederholung linearer und homogener Geschichtserzählungen, die ihre vermeintlich wissenschaftliche Unschuld (üblicherweise als Objektivität und Neutralität bezeichnet) schon längst verloren haben. Sie sind schon vor geraumer Zeit entlarvt worden als europäisch-westliche Erzählungen mit einem teleologischen Zuschnitt, der sich überhaupt nicht vermeiden lässt, solange diese Erzählungen auf Modellen von Zeit und Geschichte aufruhen, die nun einmal in dieser europäisch-christlichen Welt hervorgebracht wurden
Читать дальше