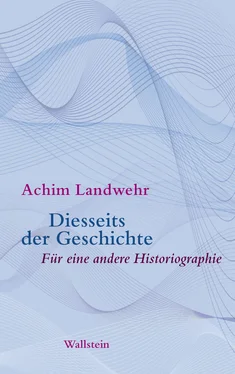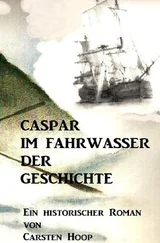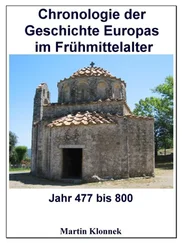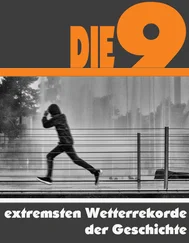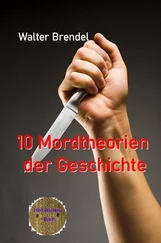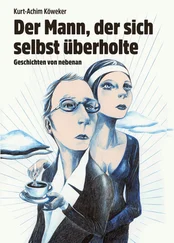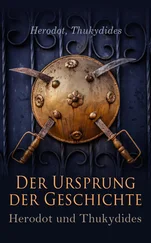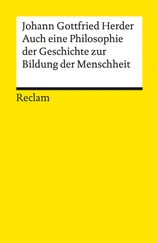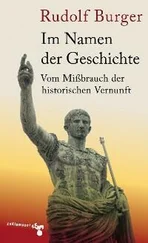Wir praktizieren diese Rede von ›der Geschichte selbst‹ aber noch nicht allzu lange. Auch wenn uns eine solche Rede und eine damit zusammenhängende Denke selbstverständlich vorkommen mag, so ist sie es doch nicht. Man müsste spätestens dann ins Grübeln geraten, wenn man feststellt, dass diese Idee von ›der Geschichte‹ selbst eine Geschichte hat. Denn wie kann etwas als Gesamtrahmung für alles Geschehen und alle Veränderungen dienen, das es gerade einmal seit etwas mehr als drei Jahrhunderten gibt? Wie kann etwas als alles erklärende Totalität herhalten, das, soweit wir bisher informiert sind, als Wort und als Konzept erstmals im Frankreich des späten 17. Jahrhunderts nachzuweisen ist,[2] sich dann im Verlauf des 18. Jahrhunderts in europäischen intellektuellen Debatten durchzusetzen begann, bevor es im 19. Jahrhundert zum Allgemeingut wurde?[3] Vielleicht ist es an der Zeit, diese Idee im 21. Jahrhundert wieder loszuwerden.
Wenn man aber schon die Historizität von ›der Geschichte‹ nicht sonderlich beunruhigend findet, dann sollte einem doch spätestens der Widerspruch zu denken geben, dass zwar die Idee von ›der Geschichte‹ die Wandelbarkeit von allem und jedem verkündet, dabei allerdings eine bedeutende Ausnahme macht – nämlich bei der Idee von der einen, großen Geschichte selbst. Ausgerechnet sie soll der historischen Veränderbarkeit nicht unterworfen sein.[4] Durch diesen Entzug ist ›die Geschichte‹ überhaupt erst in der Lage, die Aufgabe zu übernehmen, die ihr wesentlich zugedacht ist, nämlich an die Stelle der göttlichen Allmacht zu treten. Während das Vertrauen in eine göttliche Vaterfigur und deren Vorsehung über den Weltenlauf allmählich, sehr allmählich zu schwinden begann, bastelten europäische Intellektuelle an einem Ersatzgott namens ›Geschichte‹.[5] Wollte man fortan (und bis zum heutigen Tag) wissen, warum die Dinge sind, wie sie nun einmal sind, schaute man nicht mehr nach oben, sondern nach hinten.[6] Über den Geschichten, so hat es der Historiker Johann Gustav Droysen einmal formuliert, ist ›die Geschichte‹.[7]
Das führt uns wieder zurück zu dem Kind auf der Straße, das den gesuchten Verkehr nicht findet. Sicherlich wird es mit ein wenig mehr Erfahrung feststellen können, dass da Dinge zusammenhängen, oder besser: zusammengehängt werden, die sich als Verkehr bezeichnen lassen. Man kann vielleicht diesen ›Verkehr‹ ebenso wenig sehen wie ›den Staat‹, ›die Gesellschaft‹, ›die Wirtschaft‹ oder eben ›die Geschichte‹. Aber es lässt sich feststellen, dass da etwas ist. Die Frage ist nur, wie wir dieses Etwas benennen und beschreiben wollen, welche Funktionen und welche Verantwortlichkeiten wir diesem Etwas zuschieben wollen und welche Bedeutsamkeit wir ihm aufzubürden gedenken. Im frühen 21. Jahrhundert lässt sich unschwer ausmachen, dass mit dem Gesamtphänomen namens ›Verkehr‹ nicht mehr alles im Lot ist. Und dem Kollektivsingular Geschichte scheint es nicht sehr viel besser zu gehen.
Entgegen eines ersten Eindrucks handelt es sich bei solchen – zugegebenermaßen eher luftigen – Überlegungen keineswegs um eine ausschließlich akademische Angelegenheit. Auch wenn die Frage, ob die Rede vom Kollektivsingular Geschichte denn noch zutreffend sein kann, auffallend nach wissenschaftlicher Gespreiztheit tönen mag, so führt sie doch mitten hinein in die allgemeinen Fragen und Debatten, die sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts nahezu weltweit vernehmen lassen. Diese Diskussionen kreisen – mit einer nahezu sträflichen begrifflichen Unschärfe – um den Eindruck einer allgemeinen Verunsicherung. Das wirklich Verunsichernde an dieser Art der Verunsicherung ist, dass sich schwer sagen lässt, worüber man genau verunsichert sein soll. Entweder macht sie sich nur als diffuses, ungreifbares, eher gefühltes denn konkret benennbares Grundrauschen bemerkbar, das häufig gepaart mit dem Schlagwort ›Krise‹ auftritt, oder sie konkretisiert sich in einer langen Liste substantivierter Phänomene, bei der man immer den Eindruck haben darf, sie sei notorisch unvollständig: Klimawandel, Migration, Fake-News, Finanzkrise, Pandemie, Infragestellung westlicher Werte, Postfaktizität, Anthropozän, alte und neue Weltmächte, Niedergang der Demokratie, Zweifel am wissenschaftlichen Wissen, Macht der Internetkonzerne …
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lebt zumindest der privilegierte Teil der Menschheit (der es mir beispielsweise ermöglicht, diesen Text zu schreiben) in der wohl sichersten und wohlhabendsten Welt, die die Menschheitsgeschichte jemals gekannt hat. Und trotzdem (oder gerade deswegen) ist genau diese Welt voll von Verunsicherungen. Dieser privilegierte Teil der Welt scheint zu existieren in einer Spaltung zwischen Perfektion und Weltuntergang: Auf der einen Seite das bedingungslose Grundeinkommen und die Erlösung von aller Mühsal durch den umfassenden Einsatz hochkomplexer Technik vor Augen – auf der anderen Seite die mehr oder minder unmittelbare Vernichtung dieser Welt erwartend. It’s the end of the world as we know it ( and I feel fine ).
Sollen solche Phänomene, solche grundlegenden Verunsicherungen über die Wirklichkeit, in der wir leben, beschrieben werden, dann wird nahezu selbstverständlich zu historischen Erzählungen gegriffen. Das ist eben die wesentliche Aufgabe, die der Kollektivsingular Geschichte seit geraumer Zeit und bis zum heutigen Tag zu erledigen hat: einzuordnen, wie es zu dem gekommen ist, mit dem man es gerade zu tun hat. Und wie weitgehend dieser Allerklärungsinstanz namens Geschichte die Aufgabe zugewiesen worden ist, Ordnung in das selbst attestierte Chaos zu bringen, lässt sich anhand der ungemein ausgefeilten und differenzierten Geschichtskultur feststellen, die sich (post-)industrialisierte Gesellschaften leisten. Historisches durchdringt den Alltag auf allen Ebenen. Da wimmelt es nicht nur von Museen unterschiedlicher Couleur, da werden auch geschichtliche Themen in allen medialen Formen angeboten, als Buch, als Film, als Internetpräsenz, da muss sich jede größere Firma oder Institution eine eigene Geschichte geben, da werden Reenactments aufgeführt, da werden Gedenkschilder aufgestellt, da werden Computerspiele in diversen Vergangenheiten angesiedelt undsoweiter undsofort.
Aber es ist nicht nur diese Geschichtskultur, die einordnen soll, es ist noch weit mehr der Versuch, das eigene Hier und Jetzt einzusortieren in einer erweiterten Gegenwart, welche man wahlweise beginnen lassen kann mit dem 11. September 2001, dem Untergang des Ostblocks ab 1989, dem Ende des Nachkriegsbooms, den Berichten des Club of Rome , mit 1968, der Kuba-Krise oder den Prozessen der Dekolonisation. Oder sind die Grundübel nicht vielleicht schon gelegt worden in den großen Kriegen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Haben nicht vielleicht die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Kunst der Moderne oder das Fin de siècle eine Welt geschaffen, die uns zunehmend abhanden kommt, weil sie grundsätzlich unverständlich bleibt? Vielleicht lag es auch eher an den imperialistischen Kolonisierungsvorhaben des 19. Jahrhunderts, an deren Nachwirkungen die Welt bis heute leidet? Oder waren es doch die fatalen Rationalitätsversprechen der Aufklärung und der Französischen Revolution, deren dialektische Machbarkeits- und Fortschrittsparadigmen wir nicht verlassen zu können scheinen?
Keine Sorge, ich werde mich nun nicht zu einer Antwort auf diese Fragen aufschwingen. Historische Bemühungen wären hoffnungslos mit Erwartungen überfrachtet, wollte man in ihnen tatsächlich die Lösung diverser Welträtsel erkennen. Einerseits wäre die Erwartung irreführend, historische Beschreibungen würden allein durch die Darstellung einer chronologisch begründeten Kausalität bereits die Antwort auf das zugrunde liegende Problem liefern. Auf eine letztlich oberflächliche, allein dem Deskriptiven verhaftete Aufgabenzuteilung muss sich die Geschichtsschreibung nicht verpflichten lassen. Sie hat nicht nur in einem selbst auferlegten Positivismus die Frage zu beantworten, wie es denn ausgerechnet dazu gekommen ist. Schließlich hält das Historische andererseits so sehr viel mehr Möglichkeiten bereit, nicht zuletzt auch Möglichkeiten theoretischer Art,[8] um die Beschreibung, Bearbeitung und möglicherweise sogar Lösung gegenwärtiger Probleme anzugehen – Möglichkeiten, die ihr üblicherweise nicht zugetraut werden und die unter anderem in einer angemessenen Behandlung komplexer zeitlicher Verhältnisse liegen, für welche die Geschichtsschreibung eine besondere Expertise besitzen könnte und sollte. Aus der Geschichte können wir nichts mehr lernen – und gleichzeitig haben wir nur das Historische, von dem wir lernen können.
Читать дальше